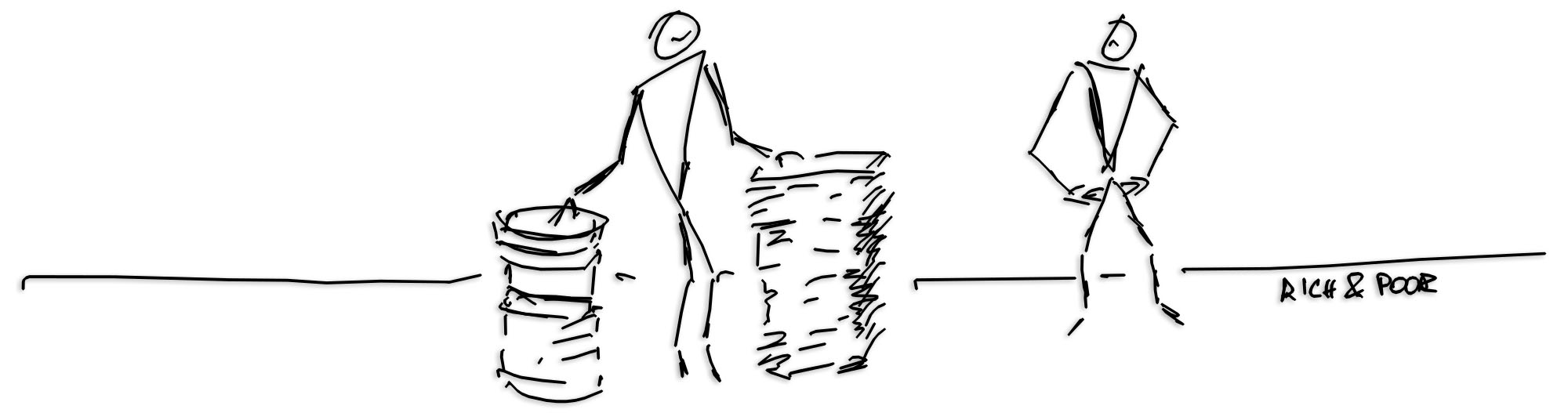Mangel – das Wort klingt negativ, fast bedrohlich. Doch je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr erkenne ich den Reiz und die verborgene Kraft, die in ihm steckt. Ein Artikel über Renata Salecl, eine Analytikerin des Mangels, hat mich dazu gebracht, meine eigene Sichtweise darauf zu hinterfragen. Besonders im Rückblick auf meine Kindheit in der DDR1, geprägt von Mangelwirtschaft, wurde mir klar: Mangel ist nicht nur eine Einschränkung, sondern kann auch eine Quelle für Kreativität, Innovation und soziale Verbundenheit sein.
Mangel als Schutz vor Übersättigung
Wir leben in einer Welt des Überflusses. Alles ist jederzeit verfügbar. Streaming-Dienste bieten unendliche Unterhaltung, Supermärkte unzählige Produktvarianten, Online-Shops liefern Waren innerhalb von Stunden. Doch dieser Überfluss führt oft nicht zu mehr Zufriedenheit, sondern zu einer Art Erschöpfung. Die Qual der Wahl kann überfordern, das Immer-Mehr erzeugt eine Art innere Leere.
In der DDR war das anders. Viele Dinge waren schlicht nicht verfügbar. Bananen waren eine Seltenheit, Westprodukte begehrte Raritäten. Doch genau dieser Mangel machte das Vorhandene wertvoll. Dinge wurden gepflegt, repariert, wiederverwendet. Der begrenzte Zugang zu Konsumgütern schuf eine natürliche Wertschätzung. Heute, wo alles in Hülle und Fülle vorhanden ist, wird oft nur noch konsumiert, ohne nachzudenken.
Mangel als Innovationsmotor
Not macht erfinderisch. Dieser Spruch bewahrheitet sich immer wieder. Mangel an Ressourcen zwingt dazu, neue Lösungen zu finden. In der DDR waren kreative Improvisationen Alltag: Ersatzteile wurden selbst gebaut, Kleidung umgenäht, technische Geräte aus vorhandenen Materialien konstruiert. Dieses Prinzip gilt nicht nur für vergangene Zeiten. Auch heute entstehen die bahnbrechendsten Innovationen oft dort, wo Ressourcen begrenzt sind. Startups, die mit geringen Mitteln großartige Ideen entwickeln, oder Entwicklungsländer, die mit minimalem Budget clevere Technologien hervorbringen, sind beste Beispiele dafür.
Mangel reduziert Neid – und damit Gewalt
Eine Überlegung, die mich besonders fasziniert: Wo weniger da ist, gibt es auch weniger Neid. In einer Gesellschaft, in der alle ungefähr gleich wenig haben, spielt Besitz eine weniger große Rolle. In der DDR gab es keine Superreichen, keine extremen sozialen Gegensätze. Das nahm dem Thema Statussymbole viel von seiner Bedeutung. In unserer heutigen Gesellschaft dagegen, wo riesige Reichtumsunterschiede existieren, führt Neid oft zu Unzufriedenheit, Spannungen und letztlich auch zu Kriminalität.
Mangel fördert Gemeinschaftssinn
Mangel bringt Menschen zusammen. Wenn bestimmte Dinge nicht verfügbar sind, werden sie geteilt oder gemeinsam genutzt. In der DDR tauschten Nachbarn untereinander, halfen sich bei Reparaturen oder organisierten in Gemeinschaftsarbeit die Versorgung. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl fehlt in unserer heutigen, individualisierten Gesellschaft oft. Wer alles für sich alleine hat, braucht niemanden. Doch genau darin liegt auch eine Gefahr: Das soziale Gefüge leidet, wenn jeder nur noch auf sich selbst schaut.
Mangel lehrt Demut
Wer den Mangel kennt, lernt Demut. Menschen, die in Wohlstand aufwachsen, nehmen viele Dinge als selbstverständlich hin. Erst, wenn etwas fehlt, erkennen wir dessen wahren Wert. In der DDR war es normal, sich an kleinen Dingen zu erfreuen. Ein Westpaket, ein seltenes Buch, eine neue Jeans – all das hatte eine Bedeutung, die heute oft fehlt. In unserer Überflussgesellschaft geht dieses Bewusstsein oft verloren. Wir konsumieren und werfen weg, ohne nachzudenken. Demut bedeutet, die Dinge bewusster zu schätzen und sich nicht als Mittelpunkt der Welt zu sehen.
Mangel inspiriert Träume
Wenn nicht alles sofort verfügbar ist, bleibt Raum für Träume. In meiner Kindheit habe ich oft von Dingen geträumt, die unerreichbar schienen. Diese Träume hatten Kraft. Sie inspirierten mich, motivierten mich, machten mich erfinderisch. Heute, wo vieles sofort erfüllt werden kann, bleibt oft wenig Platz für echte Sehnsucht. Dabei sind es gerade diese Träume, die uns antreiben und wachsen lassen.
Mangel auf der einen Seite – Überfluss auf der anderen
Interessanterweise führt Mangel oft dazu, dass an anderer Stelle ein Überfluss entsteht. Wer wenig Materielles hat, entwickelt oft einen Reichtum an Kreativität. Wer wenig Auswahl hat, besitzt oft eine Fülle an Wertschätzung. Und wer wenige Besitztümer hat, erlebt oft eine große innere Freiheit. In unserer heutigen Welt lohnt es sich daher, bewusst einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen: Wo kann weniger vielleicht mehr sein?
Fazit: Die Kunst, Mangel zu schätzen
Ich bin heute nicht mehr derselbe Mensch wie früher, als ich Mangel nur als negativ empfand. Stattdessen sehe ich ihn heute als etwas, das Wert hat. Mangel schützt vor Übersättigung, fordert unsere Kreativität heraus, verbindet uns mit anderen, lehrt uns Demut und gibt Raum für Träume. Vielleicht ist der wahre Reiz des Mangels, dass er uns auf das Wesentliche zurückführt.