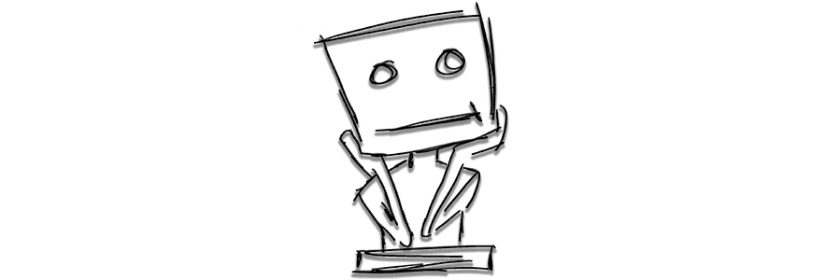Mord aus Macht? Wenn der „Gottkomplex“ eskaliert
Medizinische Berufe bieten ein enormes Machtpotenzial. Wer heilt, verfügt über Wissen, Einfluss und die Nähe zu vulnerablen Menschen. Diese Macht kann – wenn sie nicht reflektiert wird – toxisch werden. Psychologisch spricht man in diesem Kontext häufig vom sogenannten „Gottkomplex“: einem Zustand, in dem sich ein Mensch als übergeordnet, unfehlbar und allmächtig erlebt.
Im Fall von Johannes M. scheint genau das eine Rolle zu spielen. Wie die WELT berichtet, verabreichte er seinen Patienten tödliche Medikamentencocktails, ohne dass eine medizinische Notwendigkeit vorlag. Einige der Betroffenen waren nicht einmal in der terminalen Phase ihrer Krankheit. Der Verdacht: Mord aus Lust – und möglicherweise aus einem Machtrausch, der das Gefühl vermittelte, über Leben und Tod entscheiden zu können.
Der Fall Högel und weitere dunkle Kapitel
Leider ist Johannes M. kein Einzelfall. Der wohl bekannteste Serienmord eines medizinischen Angestellten in Deutschland geht auf das Konto von Niels Högel. Zwischen 1999 und 2005 tötete der Krankenpfleger in mehreren Kliniken mindestens 85 Menschen – womöglich sogar mehr. Seine Methode: Er provozierte Notfallsituationen durch Überdosierung und versuchte sich anschließend an Reanimationen. Ein perfider Mechanismus, bei dem er sich selbst als Held inszenieren wollte. [Wikipedia: Niels Högel]
Weitere Fälle wie ein verurteilter Altenpfleger aus Bremen, der Insulin nutzte, um Pflegebedürftige in Notlagen zu bringen, zeigen: Der Übergang von Pflege zur Gewalt ist nicht unmöglich, wenn Kontrollmechanismen versagen und Täter ihre Rolle missbrauchen. [BGH-Pressemitteilung]
Juristische Einordnung: Die besondere Schwere der Schuld
Die Justiz begegnet solchen Verbrechen mit aller Härte. In fast allen bekannten Fällen wurde die „besondere Schwere der Schuld“ festgestellt – eine juristische Bewertung, die eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausschließt. Warum diese Härte?
Zum einen liegt der Fokus auf der Verletzung eines besonderen Vertrauensverhältnisses. Wer sich in medizinische Hände begibt, begibt sich in eine existenzielle Abhängigkeit. Dieses Vertrauen bewusst zu zerstören, wiegt schwerer als viele andere Straftaten. Hinzu kommt die Heimtücke: Die Opfer sind nicht nur wehrlos, sie erwarten auch Hilfe statt Schaden.
Der Bundesgerichtshof (BGH) führt aus, dass bei Mord in Ausnutzung eines solchen Vertrauensverhältnisses regelmäßig von einer besonders schweren Schuld auszugehen ist – insbesondere, wenn das Handeln des Täters durch persönliche Motive wie Ruhmsucht, Kontrolle oder Lust an der Tat geprägt ist. [BGH.de]
Wenn Helfer Täter werden: Ein gesellschaftliches Trauma
Solche Fälle sind mehr als individuelle Tragödien. Sie erschüttern gesellschaftliche Grundüberzeugungen. Vertrauen ist eine zentrale Voraussetzung für jede helfende Tätigkeit – sei es in der Pflege, der Medizin oder im Rettungswesen. Wird dieses Vertrauen gebrochen, entsteht nicht nur Misstrauen gegenüber einer Person, sondern gegenüber ganzen Systemen.
Diese Erosion des Vertrauens wirkt sich langfristig aus. Patienten stellen Entscheidungen in Frage, Angehörige zögern, Pflegeeinrichtungen zu wählen. Die Unsicherheit wächst. Und wie so oft in vertrauensbasierten Strukturen ist der Vertrauensverlust viel schneller als sein Wiederaufbau.
Parallelen zur Politik: Helfer mit Macht – ein universelles Problem
Interessanterweise ist das Phänomen des Machtmissbrauchs in Helferrollen nicht auf das Gesundheitswesen beschränkt. Auch in der Politik erleben wir immer wieder, dass Menschen ihre Positionen nutzen, um egoistische oder destruktive Ziele zu verfolgen. Korruptionsskandale, Vetternwirtschaft, bewusste Desinformation – sie alle untergraben die Integrität der Demokratie.
Das verbindende Element: Verantwortung ohne Reflexion. Wer Verantwortung trägt, aber keine Rechenschaft ablegt, wer Entscheidungen trifft, ohne deren Auswirkungen zu reflektieren, gefährdet das System, in dem er agiert. Ob Arzt, Pfleger oder Politiker – wer hilft, darf nicht herrschen.
Was tun? Prävention und Kontrolle
Um solche Verbrechen künftig zu verhindern, braucht es eine Kombination aus ethischer Bildung, psychologischer Begleitung und institutioneller Kontrolle. Schon in der Ausbildung sollte das Thema Verantwortung intensiv behandelt werden – nicht als Abstraktion, sondern als konkretes Risiko.
Ebenso notwendig sind institutionelle Frühwarnsysteme: Auffälligkeiten im Verhalten von Personal müssen erfasst und ohne Angst vor Konsequenzen gemeldet werden können. Whistleblower-Schutz, anonyme Meldekanäle und unabhängige Prüfstellen können entscheidend sein, um Taten frühzeitig zu erkennen.
Schließlich sollte der Blick auch auf die Strukturen gerichtet werden, die solche Täter oft lange unbehelligt wirken lassen. Überlastung, Personalmangel, schlechte interne Kommunikation – all das kann verhindern, dass kritische Hinweise ernst genommen oder überhaupt geäußert werden.
Fazit: Der Mensch im Zentrum
Am Ende bleibt die Erkenntnis: Systeme können Regeln setzen, Strukturen schaffen und Prozesse verbessern – doch es ist der Einzelne, der sie mit Leben füllt oder missbraucht. Die Verantwortung bleibt persönlich. In helfenden Berufen vielleicht mehr als anderswo.
Der Fall Johannes M. ist ein Warnruf. Nicht nur an die Justiz oder das Gesundheitssystem, sondern an uns alle. Wo wir Vertrauen geben, muss Verantwortung folgen. Und wo Macht existiert, braucht es Kontrolle. Nur so lässt sich verhindern, dass das Helfen zum Töten wird.