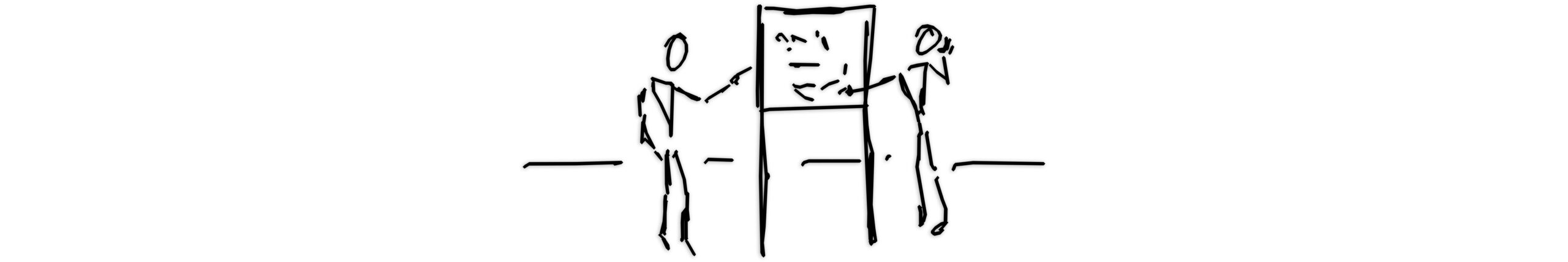Chaos – besser ohne Regeln?
Manchmal scheint es, als wäre weniger mehr: weniger Regeln, mehr Freiheit, bessere Ergebnisse. Doch gerade in hochregulierten Umgebungen – etwa in der funktionalen Sicherheit oder der Cybersecurity für die Automobilindustrie – stellt sich die Frage: Wie viel Chaos ist verkraftbar, ohne Sicherheit und Qualität zu riskieren?
Regeln als Stützräder: Wann sie helfen, wann sie stören
Regeln strukturieren, geben Orientierung und sichern Qualität. Besonders in sicherheitskritischen Bereichen wie Automotive-Software sind sie nicht bloß „nice to have“, sondern zwingend notwendig: Normen wie ISO 26262, ISO 21434, ISO 21448 (SOTIF) und Modelle wie ASPICE verlangen nachvollziehbare, dokumentierte Vorgehensweisen.
Doch Regeln können auch lähmen. Eine Überregulierung führt dazu, dass Organisationen ihre Flexibilität verlieren und individuelle Verantwortung abnimmt. Komplexität durch zu viele Vorschriften hemmt zudem die Innovationskraft und erschwert schnelle Anpassungen an neue Anforderungen. Schließlich ersetzt blindes Befolgen von Regeln häufig kritisches Denken, was langfristig zu Qualitätsverlusten führen kann.
Die Kernfrage lautet daher nicht: Regeln ja oder nein? Sondern: Welche Regeln sind wirklich nötig, und welche nicht?
Wie differenziert man: Die Kunst der richtigen Regelsetzung
Eine gute Regel erkennt man daran, dass sie einen klaren Zweck verfolgt und einen echten Mehrwert bietet. Eine Regel sollte zielorientiert sein und messbar zum Erreichen eines definierten Ziels beitragen. Gleichzeitig muss sie adaptierbar sein, sodass sie sich an neue Situationen flexibel anpassen lässt. Ebenso wichtig ist die Verständlichkeit: Die Regel muss für die Zielgruppe eindeutig und intuitiv verständlich sein. Schließlich sollte das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmen, sodass der Aufwand für die Einhaltung der Regel durch ihren tatsächlichen Nutzen gerechtfertigt wird.
Prozesse müssen daher iterativ hinterfragt und angepasst werden – ein Prinzip, das sich an agilen Methoden orientiert.
Prozessverschlankung vs. Normanforderungen: Ein scheinbarer Widerspruch?
Gerade bei Normen wie ISO 26262 oder ASPICE scheint Prozessverschlankung unmöglich. Doch der Widerspruch ist nur oberflächlich. Durch gezieltes Tailoring können Prozesse angepasst werden, ohne die Anforderungen der Normen zu verletzen, da diese meist nur eine dokumentierte und nachvollziehbare Vorgehensweise verlangen.
Der Fokus sollte dabei auf den Ergebnissen liegen, denn Audits prüfen, ob Sicherheitsziele erreicht werden, nicht, wie viele Formulare ausgefüllt wurden. Moderne Engineering-Tools unterstützen dabei, indem sie Dokumentationsaufwände automatisieren und Normkonformität effizient absichern. Schließlich hilft eine wissenszentrierte Kultur, in der Mitarbeitende das „Warum“ hinter Anforderungen verstehen, dabei, auch bei schlanken Prozessen normgerecht zu arbeiten.
Problembewusstsein statt Regeltreue: Der Schlüssel zur Prozesssicherheit
Eine zentrale Herausforderung bei verschlankten Prozessen ist es, sicherzustellen, dass Teams die Bedeutung von Sicherheit und Qualität intuitiv mitdenken. Hierfür sollten gezielte Trainings und Sensibilisierungsmaßnahmen eingeführt werden, die nicht nur über Prozesse, sondern insbesondere über die Risiken und potenziellen Folgen von Fehlern aufklären.
Erfahrungsberichte und sogenannte „Near Misses“ sollten regelmäßig geteilt werden, um konkrete Beispiele zu liefern, die stärker wirken als abstrakte Regeln. Ebenso muss eine positive Fehlerkultur etabliert werden, bei der Fehler als Lernchancen und nicht als Versagen betrachtet werden. Ergänzend dazu fördern Peer-Reviews und die Übernahme gemeinsamer Verantwortung die Aufmerksamkeit und die Eigenverantwortlichkeit im Team.
Fazit: Regellose Freiheit oder kluge Strukturen?
Chaos ist nicht gleichbedeutend mit Freiheit. Der Impuls, Regeln zu reduzieren, ist verständlich – besonders wenn Prozesse erstarrt wirken. Aber gerade bei hohen Anforderungen an Sicherheit und Qualität braucht es klug gesetzte Strukturen, die Sinn und Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die Balance liegt nicht zwischen „alles regeln“ oder „gar nichts regeln“, sondern darin, mit so wenig Regeln wie möglich, aber so vielen wie nötig eine stabile Basis für Kreativität, Qualität und Sicherheit zu schaffen.