Die Generation Z lebt in einer Welt, in der Künstliche Intelligenz (KI) längst keine Zukunftsvision mehr ist, sondern tägliche Realität – und zwar nicht nur als technischer Helfer, sondern als maßgeblicher Faktor für den Wandel auf dem Arbeitsmarkt. Die Frage, die sich immer lauter stellt: Wie berechtigt sind die Ängste der jungen Generation, durch KI ihren Berufsweg zu verlieren? Und welche Jobs gelten überhaupt noch als sicher?
Der digitale Wandel als Auslöser für Sorge und Verunsicherung
Eine aktuelle Studie zeigt: 22 Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren fürchten, dass KI ihre berufliche Zukunft gefährdet – ein signifikantes Plus gegenüber dem Vorjahr mit 17 Prozent (t3n, 2025). Besonders betroffen sind ursprüngliche Zukunfts-Branchen wie IT, Elektrotechnik und Produktion, wo bis zu 27 Prozent der Jugendlichen jetzt Zukunftsängste teilen. Gleichzeitig nutzen bereits heute viele Jugendliche KI-Tools täglich oder gelegentlich – was einerseits ihr technisches Verständnis steigert, andererseits die Angst vor Arbeitsplatzverlusten bestärkt.
Von der Panik zur Realität: Wie trostlos sind die Aussichten wirklich?
Die medial befeuerte Debatte um den „Job-Killer KI“ ist keineswegs unberechtigt. Tatsächlich sind durch Automatisierung und KI-Technologien viele traditionell repetitiv geprägte Tätigkeiten bedroht. Gleichzeitig zeigt meine Analyse, dass diese Transformation auch neue Chancen eröffnet – etwa durch den Entfall lästiger Routineaufgaben und die Schaffung neuer Berufsbilder im KI-Umfeld.
Dennoch besteht eine realistische Sorge, dass viele nicht-bürokratische Berufe, oft mit geringer gesellschaftlicher Wertschätzung, wegen fehlender digitaler Anpassung oder Automatisierungswucht unter Druck geraten. Das Gefühl geringer Wertigkeit der eigenen Arbeit verstärkt das Empfinden, überflüssig zu werden, wie die aktuellen Studien zeigen.
Welche Berufe sind wirklich KI-sicher?
Eine verlässliche „KI-Sicherheit“ gibt es kaum, aber einige Berufsgruppen gelten derzeit als weniger gefährdet. Dazu zählen vor allem Tätigkeiten, die hohe soziale, kreative oder emotionale Kompetenzen verlangen – etwa im Pflegebereich, in sozialen Berufen oder handwerklichen und künstlerischen Bereichen (t3n, 2025).
Denn KI kann zwar Prozesse optimieren und Routineaufgaben übernehmen, doch menschliche Urteilsfähigkeit, Empathie und kreative Problemlösung bleiben aktuell noch weitestgehend unersetzlich. Doch der technologische Fortschritt lässt vermuten, dass auch viele heute sichere Jobs in Zukunft neu bewertet werden müssen.
Politisches Eingreifen: Notwendig oder chancenlos?
Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage nach der Rolle der Politik. Soll sie intervenieren, regulieren und lenken? Ein klares Ja, kommentieren Experten. Denn ohne gezielte Maßnahmen drohen soziale Verwerfungen, die Ängste der jungen Generation könnten sich verstärken und die gesellschaftliche Spaltung wachsen (42thinking, 2025).
Ob Politik allerdings das Tempo und die Tiefenwirkung der KI-Revolution versteht und adäquat begleitet, ist umstritten. Eine vielversprechende Idee wäre vermutlich die Einrichtung eines Bürgerforums, das Experten, Betroffene und Entscheidungsträger zusammenbringt, um realistische Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Dieses Modell könnte Transparenz schaffen und Ängste offen adressieren – ein wichtiger Schritt, um die Akzeptanz für notwendige gesellschaftliche Anpassungen zu fördern.
Fazit: Zwischen Sorge und Aufbruch
Die Generation Z erlebt eine doppelte Realität: Einerseits wächst das Verständnis für KI und deren Nutzen, andererseits sind Ängste vor Jobverlust und gesellschaftlicher Entwertung präsent. Der digitale Wandel ist eine Herausforderung, aber auch eine Gelegenheit, Arbeit neu zu denken und junge Menschen gezielt auf die Zukunft vorzubereiten.
Für eine erfolgreiche Transformation braucht es mehr als nur technologische Innovation: Bildung, gesellschaftlicher Dialog und politische Weitsicht sind unverzichtbar, um die Chancen der KI zu nutzen und gleichzeitig die berechtigten Ängste ernst zu nehmen.

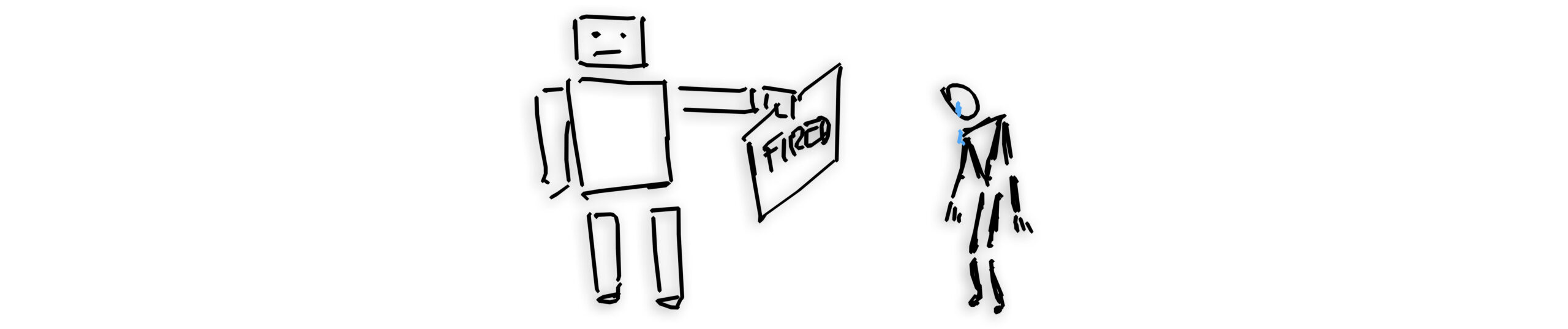
guten Abend, „Berechtigte Ängste oder nur Panik?“
was für eine Frage und welcher Adressat…
A) nicht NUR die GenZ ist betroffen! Alle, die irgendwie mit Information arbeiten, von Terminplanen bis zu Ingenieursarbeiten, sind betroffen! Sei es, das der Zahlungswille für eine Leistung wegbricht oder eine Leistung in vergleichbarer Geschwindigkeit erbracht werden soll, es ist jeder betroffen!
Vergleichbar mit dem Zusammenbruch des Einzelhandels durch das Internetbusiness!
Dann die Frage „Politisches Eingreifen: Notwendig oder chancenlos?“
Dieses Verkennen der maßlos begrenzten Möglichkeiten von falschinformierten Politiker am falschen Ende der Entscheidungskette macht mich fassungslos! Wie bitte will wer verhindern, das eine Software x oder Y von irgend jemandem genutz oder mißbracht wird? Die Software ist schneller in Umlauf, als ein Gremium die Tragweite erkannt und Vorschläge ausgearbeitet hat! Bis eine Entscheidung getroffen ist, vergehen noch mals Jahre! Was das in der IT bedeuted, ist jedem klar!!!
Unsere Erfahrung mit dem Vorsprung Krimineller gegenüber der Polizei, was Nutzung des Internets betrifft, klärt doch nur zu deutlich auf, wo die Rechtschaffenden stehen.
Und politischer Wille erzeugt keine Intelligenz, die notwendig ist, um das Monster zu beschreiben und zu warnen!
KI bedeuted das Ende der Freiheit zu denken!!!
mehr als 50% des „Gesprächsverkehrs“ im Internet, also Mails aller Art, werden mittlerweile von Bots erstellt! Man berücksichtige den Energieverbrauch, den das vernichtet!!! Alle Handys zusammen verbrauchen den Strom, den FÜNF mittlere Atomkraftwerke produzieren!!!
„Fazit: Zwischen Sorge und Aufbruch“
Aufbruch ??? Wohin ??? in eine Zukunft, in der alle Pfleger, Ärzte, und Lehrer sein müssen/sollen, um die
Menge der Verwaltungen zu ernähren mit Steuer und Abgaben??? Kranksein nur noch in diesen Berufsgruppen erlaubt ist? Rentner sein könnte bei Schnupfen tödlich sein??? Geld als Tauschmittel ist auf Vertrauen aufgebaut – das wird zusammenbrechen!
Mir fallen bei solchen optimistischen Gedanken immer die ägyptischen Pyramiden, die grieschischen Säulen ein oder die Bauwerke in Rom! Wie konnte es passieren, das viele solcher Hochkulturen heute verschwunden sind??? Ich habe RIESEN-Angst vor der Zukunft, weil ich mit meinen fast 70 Jahren die Geschwindigkeit der Entwicklung erkennen kann! Nicht das eine Detail macht Angst, das Zusammenwirken aller Komponenten erzeugt die Panik! Kriege sind mit drei Nachrichten vom Zaun gebrochen! Wer kann da noch den Urheber der Nachrichten erkennen? KI? Wer wird Berater gegen KI?
Nutzen? Gib mir fünf Euro und ich erlöse dich und schlag die den Schädel ein.
Ein gute Investition? „Schaden erleben“ erspart?
Nach meine Erlebnissen würde ich meine Letzten Fünf Euro genau so einsetzen!
Ich wäre glücklicher gestorben, hätte ich die letzten Jahre nicht erleben müssen!
Nutzen für wen?
Für die sehr wenigen, die Sklaven brauchen und den Sklaven ihren Sinn einreden können!
Ich schreibe mich in Frust, zu viel Lug und Betrug zur Kenntnis nehmen müssen, besonders in den letzten Tagen on Top!
Angst? Nein -eigentlich nicht mehr.
der letzte macht das Licht aus – ich muß es nicht sein.
Liebe Grüße Wolfgang
PS:
lieber Andy, du bist nicht der einzige, der mit solchen Fragen versucht, etwas Klarheit in den Nebel zu bringen. Viele bemühen sich mit Optimismus dem Gespenst, dem ungreifbaren, etwas positives abzugewinnen! Aber auch die beste Wettervorhersage hat keinen Einfluß auf das Wetter – siehe letzten Wirbelsturm Melissa über Jamaika. Auch keine Vukanvorhersage hat Einfluß auf den Ausbruch oder die Stärke der Beben.
Unterm Strich sehe ich das Zusammenwachsen der Menschheit mit Hilfe der Technik, vom Automobil übers Telefon hin bis zu den letzten Errungenschaften als ein tragisches Experiment! Seit der Findung der Kraft der Atom-schmelze ist noch jede friedlich gedachte Erfindung militärisch oder Kriminell mißbraucht worden! Gute nacht Freunde…