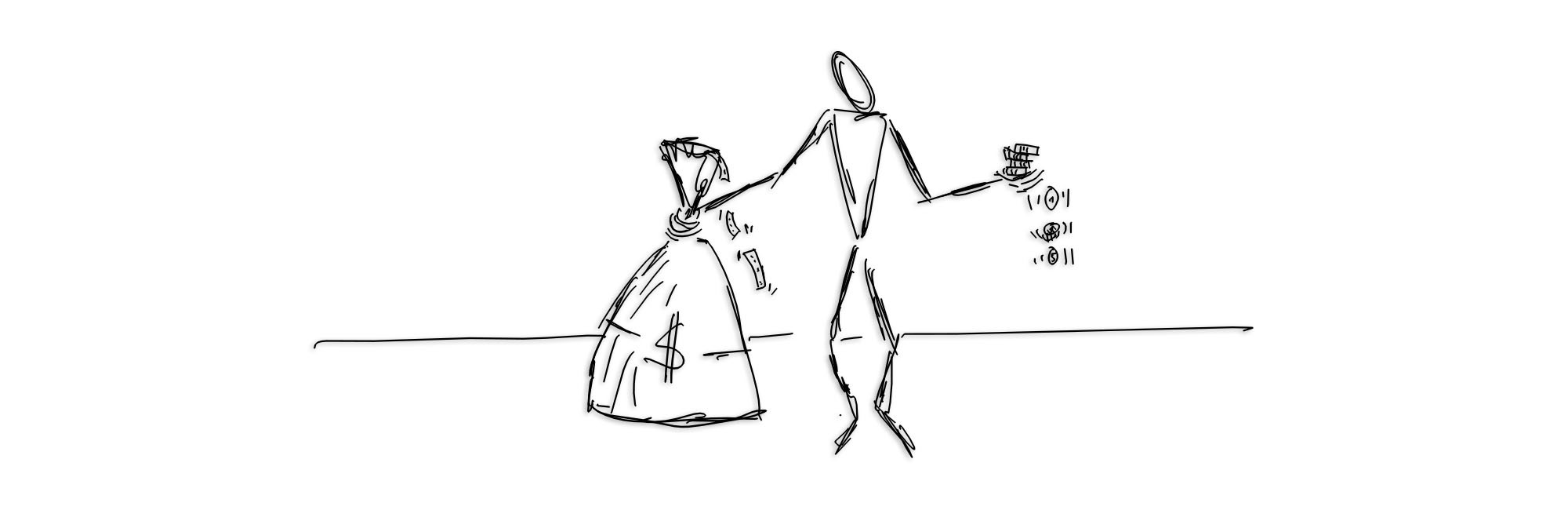Besitz ist allgegenwärtig – materiell wie immateriell. Wir reden über Eigentum, geistige Rechte, Datensouveränität oder Erbschaften. Doch was bedeutet es eigentlich, etwas zu besitzen? Und was verrät die Sprache selbst über unsere Beziehung zum Besitz? Eine sprachphilosophische Reise von den Wurzeln des Wortes bis zur Frage nach der Endlichkeit des Geistigen.
Von „sitzen“ zu „besitzen“: Etymologie als Spiegel kultureller Haltung
Das deutsche Wort besitzen geht auf das mittelhochdeutsche „besitzen“ und althochdeutsche „besiszan“ zurück – zusammengesetzt aus be- und sitzen. Wörtlich bedeutete es einst: „etwas besetzt halten“, „darauf sitzen“, „in Besitz nehmen“. Der Sitz – der Ort des Verweilens, des Beherrschens, des Verfügbarmachens – wurde zur Metapher für das Eigentum.
Diese Verbindung ist keine sprachliche Eigenheit des Deutschen. Auch im Englischen liegt eine ähnliche Nähe vor: „to sit“ und „to possess“ scheinen zwar zunächst getrennt, doch der Ausdruck „to sit on something“ meint nicht selten „etwas besitzen (und nicht teilen)“. Besitz beginnt also mit dem Sitzen – dem Festhalten, dem Nicht-Weitergeben.
In diesem Bild schwingt bereits eine Haltung mit: Besitz ist, was man kontrolliert, worauf man sitzt, was man sich aneignet. Sprache zeigt, dass Besitz nicht nur eine rechtliche Kategorie ist, sondern eine Frage der Haltung zur Welt – und oft: zur Macht.
Besitz und Horten: Sprachlich, kulturell, psychologisch
Auch das Wort horten ist mehr als ein moderner Ausdruck für übertriebene Vorratshaltung. Es hat eine lange Geschichte: Das Verb stammt vom lateinischen „hortari“ – ursprünglich im Sinne von „zusammenrufen, antreiben“, später auch „ansammeln“. Im Deutschen entwickelte sich daraus das Substantiv „Hort“ (Schatz, Aufbewahrungsort) und schließlich das Verb „horten“.
Interessant ist, dass „horten“ oft eine negative Konnotation trägt – im Gegensatz zu „besitzen“, das als neutral oder sogar positiv konnotiert gilt. Horten suggeriert Übermaß, Unnötigkeit, vielleicht sogar Geiz. Besitz hingegen klingt geordnet, legitim, rational.
Doch wo liegt die Grenze? Wann wird legitimer Besitz zum krankhaften Horten? Die Psychologie spricht hier von Messie-Syndromen, die Soziologie von Akkumulation, die Philosophie von Besitzideologien. In allen Fällen schwingt mit: Besitz kann aus dem Gleichgewicht geraten. Sprache bildet diese Nuancen subtil ab.
Materieller vs. geistiger Besitz: Zwei Seiten derselben Medaille?
In der digitalen Wissensgesellschaft ist geistiges Eigentum längst zu einem zentralen Begriff geworden. Doch wie unterscheidet sich dieser von materiellem Besitz? Während man ein Haus „besitzt“ und abschließen kann, ist ein Gedanke schwerlich einzusperren – selbst wenn das Urheberrecht es versucht.
Materieller Besitz ist exklusiv: Wenn ich eine Tasse habe, kannst du sie nicht gleichzeitig nutzen. Geistiger Besitz hingegen ist teilbar, ohne zu verlieren. Wenn ich dir eine Idee erzähle, bleibt sie auch meine. Das stellt klassische Besitzlogik auf den Kopf.
Dennoch: Sprache behandelt beide Formen oft gleich. Wir „haben“ Wissen, „besitzen“ Patente, „sichern“ Daten. Auch hier spiegelt sich eine Haltung: Wissen wird nicht nur geteilt, sondern auch gesichert, geschützt – manchmal sogar gehortet.
Damit verbunden ist eine ethische Frage: Ist geistiger Besitz überhaupt „Besitz“ im eigentlichen Sinne? Oder handelt es sich um eine kulturell geprägte Fiktion, die aus wirtschaftlichem Interesse geschaffen wurde? Sprache hilft hier, kritisch zu reflektieren, wie wir mit Wissen umgehen – als Gemeingut oder als Ware.
Ist geistiger Besitz endlich? Über Sterblichkeit und Weitergabe des Denkens
Ein weiterer spannender Aspekt: die Endlichkeit geistigen Besitzes. Materielles kann vererbt, verkauft oder zerstört werden – doch wie steht es um Gedanken, Ideen, Erkenntnisse?
Im ersten Moment scheint geistiger Besitz unendlich: Ideen verbreiten sich, vervielfältigen sich, wandeln sich. Doch er ist auch sterblich – in zweifacher Hinsicht. Zum einen kann Wissen verloren gehen: durch Tod, Vergessen, fehlende Weitergabe. Zum anderen ist geistiger Besitz oft an Individuen gebunden – an ihre Sprache, ihre Zeit, ihren Kontext.
Ein Beispiel: Manuskripte antiker Denker, die verloren gingen. Ihr Wissen, einst präsent, ist für immer verschwunden. Oder digitale Daten, die in veralteten Formaten unlesbar werden – obwohl sie „irgendwo“ noch existieren.
Geistiger Besitz ist also nicht nur fragil, sondern auch kontextabhängig. Er braucht ein Medium, eine Gemeinschaft, eine Sprache, um lebendig zu bleiben. Ohne das alles wird auch die brillanteste Idee stumm.
Begriffliche Zerlegung: Eigentum, Eigen + Tum – und das Eigene im „Eigentümlichen“
Ein Blick auf das Wort Eigentum offenbart eine interessante sprachliche Konstruktion: Es setzt sich aus eigen und dem Suffix -tum zusammen. Während eigen auf das Persönliche, das Individuelle verweist, steht -tum für einen Zustand oder eine Gesamtheit – wie bei „Reichtum“ oder „Christentum“. Eigentum ist also wörtlich „das, was einem eigen ist“, das, was zur eigenen Sphäre gehört und von anderen abgegrenzt wird.
Bemerkenswert ist, wie sich daraus das Adjektiv eigentümlich entwickelt hat. Ursprünglich bedeutete es „zum Eigentum gehörig, eigen“, doch im heutigen Sprachgebrauch beschreibt es etwas Sonderbares, Merkwürdiges, Abweichendes. Die Bedeutungsverschiebung ist frappierend: Aus dem, was ursprünglich einfach „das Eigene“ war, wird nun das Ungewöhnliche, das vom Gewohnten Abweichende. Hier zeigt sich, wie Sprache Bedeutungen verschiebt und das Verhältnis zum Eigenen neu bewertet – manchmal ins Positive, manchmal ins Negative.
Auch eigentlich ist ein verwandtes Wort, das im Alltag oft zur Relativierung dient: „Eigentlich wollte ich…“ oder „Eigentlich ist es so…“. Es verweist auf den Kern, das Wesen einer Sache – und damit auf das, was ihr „eigen“ ist. Doch gerade diese sprachliche Wendung entfernt sich oft vom Konkreten, wird zur Ausflucht oder zur Abschwächung. So offenbart die Sprache, dass das Eigene, das Eigentum, nicht nur Besitz und Abgrenzung meint, sondern auch Unsicherheit, Wandel und Distanz in sich trägt.
Die begriffliche Zerlegung von Eigentum zeigt: Was uns scheinbar selbstverständlich erscheint, ist in Wahrheit das Ergebnis sprachlicher und kultureller Aushandlungsprozesse. Eigentum ist nicht nur Besitz, sondern immer auch Interpretation – und manchmal sogar das Gegenteil des Gewöhnlichen: das Eigentümliche.
Fazit: Besitzdenken neu denken
Die sprachlichen Wurzeln des Besitzes offenbaren tiefe kulturelle Muster. Besitz ist nicht nur ein Zustand, sondern ein Handeln – ein Sitzen, ein Festhalten, ein Kontrollieren. Sprache zeigt, dass unser Verhältnis zum Eigentum von Anfang an ambivalent ist: zwischen Schutz und Ausschluss, zwischen Bewahrung und Horten.
Besonders im digitalen Zeitalter fordert uns der Begriff des geistigen Besitzes heraus. Er konfrontiert uns mit Fragen nach Teilbarkeit, Endlichkeit und Verantwortung. Vielleicht ist es an der Zeit, Besitz neu zu denken – nicht als das, worauf wir sitzen, sondern als das, was wir mit anderen teilen können, ohne es zu verlieren.
Literaturhinweise
-
Arendt, Hannah: Vita activa oder Vom tätigen Leben. Piper Verlag, 1960.
-
Binswanger, Hans Christoph: *Geld und Magie: Eine ökonomische Deutung von Goethes