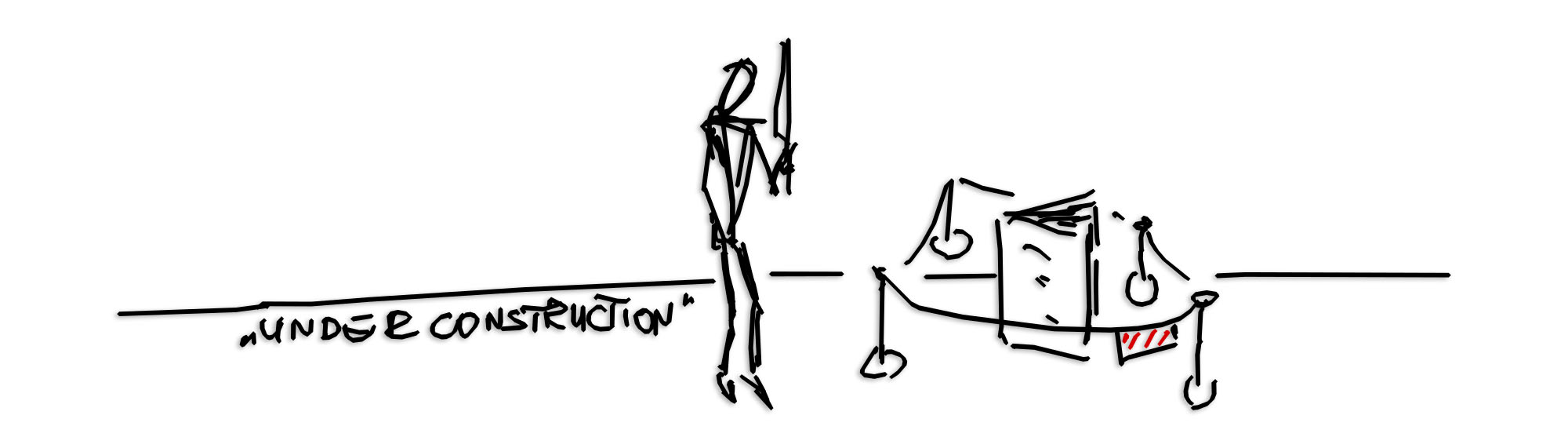Lesen ist für mich eine Art Zauberkunst – eine leise Superkraft, die sich irgendwann zwischen Bild, Buchstabe und Bedeutung entfaltet. Eine Fähigkeit, die wir als Menschheit kultiviert haben wie kaum eine zweite. Und doch ist sie alles andere als selbstverständlich. Im Alltag begegnet mir diese Erkenntnis immer wieder. Denn Lesen – das merke ich besonders bei Kindern – ist kein Selbstläufer. Und schon gar kein universelles Vergnügen.
Da ist zum Beispiel Ivo. Neun Jahre alt, pfiffig, wach, voller Ideen. Ein Kind, das Löcher in den Himmel fragt, sich für alles interessiert – außer für Bücher. Wenn ihm ein Text begegnet, verzieht sich sein Blick. „Warum tun mir die Augen so weh, wenn ich lese?“, fragt er dann. Oder schlicht: „Wieso macht das keinen Spaß?“
Ivo ist eine fiktive Figur – und doch verdammt echt. In ihm bündeln sich viele der Erfahrungen, die ich als Ingenieur und Vater über die Jahre gesammelt habe. Ivo gehört zu den Kindern, die neugierig und klug sind, aber beim Lesen aussteigen. Weil Buchstaben keinen Klang haben. Weil Geschichten zu sperrig erzählt sind. Weil Themen an ihnen vorbei gehen. Oder weil ihnen noch niemand gezeigt hat, dass ein Buch auch ein Zuhause sein kann.
Eine seiner Fragen lässt mich bis heute nicht los: „Wieso müssen wir überhaupt lesen?“ Daran hängt so vieles. Denn hinter dem Müssen steht oft ein ganzes Bildungssystem. Hinter dem Lesen steht Teilhabe. Zugang zur Welt. Zur Sprache der anderen – und zur eigenen.
Lesen ist Kulturtechnik, ja – aber genauso Einladung. Wer liest, kann Welten entdecken. Sich selbst besser verstehen. Doch damit das gelingt, braucht es mehr als Methoden. Es braucht Geschichten, die etwas auslösen. Und vielleicht auch einfach mal: einen Ivo, der uns daran erinnert, wie schwer der erste Schritt sein kann – und wie wertvoll es ist, dranzubleiben.
Spoiler: Ivo ist der Titelheld meines nächsten Buches – ja, ein Kinderbuch. Und seine Lesereise hat gerade erst begonnen.
Lesen können – Grundbedürfnis in einer komplexen Gesellschaft
Lesen ist mehr als eine schulische Kompetenz – es ist Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Wer nicht lesen kann, ist im öffentlichen Raum oft aufgeschmissen. Keine Fahrpläne, keine Formulare, keine Warnhinweise, keine Verträge – was auf den ersten Blick banal klingt, wird ziemlich schnell entscheidend.
Laut der LEO-Studie (2021) der Universität Hamburg können rund 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland nicht ausreichend lesen oder schreiben, um an unserer Gesellschaft voll teilnehmen zu können. 6,2 Millionen. Das ist keine Randgruppe – das sind Menschen in unserer Mitte.
Und damit ist nicht gemeint, dass diese Menschen gar nicht lesen können. Viele von ihnen kommen im Alltag einigermaßen zurecht – können Preisschilder entziffern, einfache Sätze verstehen, vielleicht WhatsApp-Nachrichten tippen. Aber: Längere Texte, komplexere Informationen, juristische oder technische Sprache bleiben ihnen verschlossen. Die Folge? Sie sind strukturell benachteiligt – im Beruf, in der Verwaltung, in politischen Prozessen.
Wer sich zwischen einer Stromabrechnung und einem Mietvertrag durchhangeln muss, weiß, wie anspruchsvoll unser Alltag sprachlich geworden ist. „Leichte Sprache“ klinkt oft wie Gnade – dabei wäre sie für viele Menschen schlicht der Unterschied zwischen Teilhabe und Ausschluss. Und das, obwohl wir davon ausgehen, dass alle Erwachsenen irgendwie „lesen können“. Ein Trugschluss.
Ich selbst ertappe mich regelmäßig dabei, wie selbstverständlich ich voraussetze, dass mein Gegenüber Texte versteht – Bedienungsanleitungen, Sicherheitsangaben, komplexe Diagramme, Artikel, E-Mails. In der technischen Welt, in der ich mich bewege, ist das keine Nebensache. Missverständnisse kosten Geld, Zeit – und manchmal Sicherheit.
Lesen ist damit kein rein sprachliches Thema. Es geht um Zugänge – zu Berufen, zu Technologien, zu gesellschaftlicher Teilhabe. Um die Fähigkeit, sich eine Meinung zu bilden, mitzureden, mitzudenken. Wer den Unterschied zwischen „lesen“ und „verstehen“ unterschätzt, verliert mitunter den Blick für die Realität vieler Menschen. Und das betrifft nicht nur andere – das betrifft unser gemeinsames Funktionieren.
Ein System, das auf schriftlicher Information basiert, muss sich fragen: Was tun wir für die Verständlichkeit? Und was tun wir für diejenigen, die durchs Raster fallen? Die Antwort darauf ist keine pädagogische – sondern eine gesellschaftspolitische. Und sie beginnt bei der Anerkennung: Lesen zu können ist keine Selbstverständlichkeit. Aber es ist Voraussetzung dafür, dass vieles andere selbstverständlich sein darf.
Lesen müssen – und wie Motivation dabei auf der Strecke bleibt
Kinder lernen Lesen. Erst mit Silbenbögen, Wimmelbildern und den ersten Buchstaben in schiefen Linien – eine Entdeckungsreise in eine neue Welt. Doch was neugierig beginnt, wird oft von der schulischen Realität eingefangen: Lesetests, Lesetempo, Pflichttexte. Damit rücken Wesen und Wirkung des Lesens in den Hintergrund – es bleibt ein „Du musst“. Und genau dabei geht etwas verloren: der Impuls, aus eigenem Antrieb zu lesen.
Das „Lesen müssen“ degradiert das Lesen zur Technik. Zum Werkzeug, das funktionieren soll – möglichst fehlerfrei, möglichst schnell. Doch wie viel von dieser inneren Bewegung bleibt zurück, wenn Lesebücher mehr Drill als Einladung sind? Wenn der einzige Sinn im Leseverstehenstest der Punktzahl liegt?
Ich erinnere mich an einen Moment in der Nähe eines Schulhofs: Ein Kind, etwa dritte Klasse, hatte ein dünnes Buch in der Hand und sagte zu einem anderen: „Muss ich dieses Wochenende lesen. Leider.“ Kein Ausruf wie „Spannend!“ oder „Endlich weiterlesen!“, sondern: leider. Das ist bezeichnend.
Auch bei Ivo – der Figur, die mich zum Nachdenken brachte – zeigt sich das: Sobald ein Buch Pflicht ist, schaltet er ab. Er mag Geschichten. Er liebt Fantasie. Aber er erkennt den Unterschied zwischen einer Geschichte, die er selbst entdeckt – und einer, die ihm vorsetzt, was angeblich „für ihn gut“ ist.
Und dabei sprechen wir hier nicht über ein Lesedefizit, sondern über ein Motivationsvakuum. Denn viele Kinder *könnten* lesen – sie *wollen* nur nicht (mehr). Nicht, weil sie zu faul wären. Sondern weil sie sich nicht wiederfinden in den Texten, die ihnen angeboten werden. Weil Sprache zu kompliziert, Handlung zu weit entfernt, Perspektiven zu fremd sind.
Es geht hier nicht um die Frage, ob Kinder Bücher brauchen – natürlich tun sie das. Sondern darum, wie frei sie sich in diesem Medium bewegen dürfen. Darf man ein Buch abbrechen? Darf man Comics lesen? Darf man dasselbe Buch zehnmal lesen? Wer Kinder auf diese Fragen keine offenen Antworten geben lässt, drängt sie aus der Welt der Wörter, weil er die eigene Vorstellung vom Guten über deren Begeisterung stellt.
Lesemotivation wächst nicht aus Zwang – sondern aus Resonanz. Erst wenn ein Text etwas spiegelt, etwas andockt, kann ein inneres Feuer entstehen. Und dieses Feuer ist viel flüchtiger, als man denkt. Es braucht Pflege – nicht Kontrolle. Es braucht Begegnung – nicht Bewertung. Und es braucht Formate, die anerkennen, dass der Zugang zum Lesen individuell ist: sprachlich, thematisch, strukturell.
Lesenlernen bedeutet auch: Fehler machen dürfen. Pausen machen. Umwege gehen. Manchmal sogar: erst später zurückkommen. Denn nicht jedes Buch führt direkt zum Ziel – aber jedes kann ein möglicher Wegweiser sein. Wenn man es denn lässt.
Lesen wollen – wie Interesse keimen kann
Es braucht Neugier und Relevanz, damit aus einem „Ich muss“ ein „Ich will“ entstehen kann. Denn echtes Leseinteresse wächst nicht auf Kommando – es keimt dort, wo ein Text berührt, wo Sprache nicht abschreckt, sondern andockt. Und genau das ist der Zauber des individuellen Zugangs: Wenn ein Kind sich in einem Buch wiederfindet, taucht es ganz von selbst hinein.
Warum sollte ein Kind lesen wollen? Weil es darin etwas entdeckt, das mit seinem Leben zu tun hat. Weil es Figuren begegnet, die ähnlich empfinden. Oder weil die Geschichte einfach genau in den inneren Klang dieser kleinen Person trifft. Es sind selten die „großen“ Werke, die das Feuer entfachen – eher wenige, sehr persönliche Bücher, die zu einem Eigenen werden.
Der Individualitätsfaktor dabei ist enorm: Ein Kind, das für Rittergeschichten brennt, wird nur schwer mit Gedichtanalysen zur Industrialisierung warm. Ein Teenager, der sich über Mangas seine Welt erschließt, reagiert auf Goethe womöglich mit Achselzucken. Und das ist kein Bildungsdefizit – das ist schlicht ein Missverhältnis zwischen Angebot und Resonanzbereitschaft.
Lesemotivation hat weniger mit Disziplin zu tun als mit innerer Verbindung. Deshalb braucht es mehr Mut zur Öffnung: Mehr Diversität in den Büchernregalen. Mehr Differenzierung in der Ansprache. Mehr Erlaubnis zur Wiederholung, zur Auswahl, zum Wieder-Erkennen. Wenn ein Kind ein Buch dreimal liest, ist das kein Zeichen mangelnden Fortschritts – sondern ein Zeichen dafür, dass es in dieser Geschichte etwas findet, das ihm Halt gibt. Das ist wertvoll.
Auch die Formate können variieren: Comics, Hörbücher, Lesespiele, interaktive Apps – sie sind keine „schlechteren“ Medien, sondern Einstiegspunkte. Wer sagt, dass Lesen nur mit Papier beginnt? Manchmal ist es ein Bildschirm, der die Tür öffnet. Manchmal ein Gespräch, ein Vorbild, ein Satz, den jemand einfach mal laut vorliest. Hauptsache, es trifft den richtigen Nerv.
Ich denke wieder an Ivo, diese fiktive – und doch so greifbare – Figur. Er liebt Bewegung, lacht viel, stellt geniale Fragen. Und Bücher? Sind für ihn oft nur Buchstabenwände. Aber wenn ich ihm eine Geschichte erzähle, die ihn meint, beginnt er zu lauschen. Vielleicht erst nur mit den Ohren. Aber irgendwann, vielleicht, auch mit den Augen. Lesen wollen ist nicht der erste Schritt – aber vielleicht der entscheidende.
Fazit: Das individualisierte Buch – Sprachrohr ins Ich
Individuelles Lesen heißt nicht, dass jedes Kind sein eigenes Buch schreiben muss – aber dass jedes Kind ein Buch finden kann, das zu ihm spricht. Zu seinem Tempo. Zu seinen Gedanken. Zu dem Punkt, an dem es gerade steht. Ein Buch, das weder überfordert noch unterfordert, sondern einlädt – auf Augenhöhe, in Sprache aber auch im Schriftgrad.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der Bücher oft über Kinder gestülpt werden, ohne zu fragen: Was brauchst du, um dich darin wiederzufinden? Es ist ein bisschen wie bei Schuhen – nicht jeder passt jedem. Was nützt die schönste Zehnerreihe, wenn sie drückt? Oder der Klassiker, den alle gelesen haben – aber keiner verstanden?
Ich arbeite gerade an meinem nächsten Buchprojekt. Es wird ein Kinderbuch. Kein pädagogisches Instrument. Keine Therapiestunde. Sondern eine Geschichte, die Raum lässt – für eigene Gedanken, für Unsicherheiten, für leises Staunen. Eine Art Versuchsanordnung: Klare Sprache, eine emotionale Erzählung, ein Plot, der bewusst offene Stellen hat. Weil Kinder Fragen verdienen. Nicht sofort Antworten.

Der Titelheld – Ivo – ist inspiriert von vielen Beobachtungen. Kindern, die klug sind, wach, originell – aber beim Lesen (noch) aussteigen. Nicht, weil sie es nicht könnten. Sondern weil ihnen noch niemand das eine Buch in die Hand gegeben hat. Das, bei dem etwas springt. Und wenn man einmal einen solchen Moment erlebt hat, vergisst man ihn nicht mehr.
Ich glaube fest daran: Motivation ist kein Automatismus. Sie wächst da, wo jemand merkt: „Das berührt mich.“ Oder: „Das verstehe ich auf meine Weise.“ Und oft braucht es dafür nur sehr wenig – Aufmerksamkeit, Ermutigung und das passende erste Buch. Kein Bestseller, kein Kanon, sondern eines, das sagt: Du bist gemeint.
Lesen dürfen – nicht müssen – das bleibt für mich der schönste Teil an der Sache. Vielleicht wird Ivos Geschichte für manche Kinder genau das: ein Anfang. Kein Überreden. Kein Erziehen. Nur ein stilles „Vielleicht willst du es ja mal versuchen?“
Weiterführende Links
- Funktionaler Analphabetismus im europäischen Vergleich – Meta-Analyse (PLOS ONE)
- BIBB: Grundbildung am Arbeitsplatz – Handlungsfelder der Weiterbildung
- Alpha-Fundsachen – Geschichten aus der Lebensrealität gering literalisierter Erwachsener
- Stiftung Lesen: Lesesozialisation – Einblicke in Motivationsforschung
- Lesemotivation: Warum Kinder lesen – oder nicht
- Kindermedienland BW: Leseforschung im Kontext digitaler Medien
- Stiftung Lesen: Lesesozialisation – wie Lesebiografien entstehen
- Vielfalt im Bücherregal – Leseförderung durch Diversität
- Lesestart 1–2–3: Frühkindliche Leseförderung durch passende Geschichten
- LEO 2021: Leben mit geringer Literalität – Universität Hamburg
- Stiftung Lesen – Impulse für individuelle Leseförderung
- Leseförderung in der Kinder- und Jugendbildung