Es ist eine dieser Fragen, die man sich immer wieder stellt, wenn man das politische Tagesgeschäft betrachtet: Können erwachsene Menschen wirklich so dumm sein? Oder steckt da doch mehr dahinter?
Schaut man sich das politische Geschehen in Deutschland und den USA an, könnte man den Eindruck gewinnen, dass kritischer Geist und unabhängiges Denken in Parteien so willkommen sind wie ein Schneesturm im August. Früher war Protest gegen die Parteiführung zumindest ein Zeichen von Restverstand – heute scheint das Hirn auf Standby geschaltet zu sein.
Republikaner: Die Angst regiert
Ein Blick über den Atlantik zeigt das Paradebeispiel für bedingungslose Gefolgschaft. Die Republikaner, einst eine Partei mit konservativen Idealen, haben sich längst in eine sektenähnliche Bewegung verwandelt, die blind einem Anführer folgt, der mit jeder Silbe beweist, dass Wahrheit und Anstand für ihn Fremdwörter sind. Man könnte meinen, dass dort niemand ernsthaft glaubt, was Donald Trump von sich gibt – aber warum erhebt dann kaum jemand die Stimme? Angst regiert. Angst vor dem Karriereende, Angst vor der Wutbasis, Angst vor der Realität.
Demokraten: Opposition gegen wen genau?
Auch bei den Demokraten bleibt oft erstaunlich wenig Widerstand gegen die Parteiführung. Joe Biden, mittlerweile als einer der ältesten und umstrittensten Präsidenten in der US-Geschichte, wird von vielen nur noch aus Mangel an Alternativen unterstützt. Dennoch gibt es kaum nennenswerte Gegenstimmen aus den eigenen Reihen. Progressive Kräfte wie Bernie Sanders oder Alexandria Ocasio-Cortez kritisieren zwar einzelne Punkte, doch ein echter Machtkampf bleibt aus. Der Grund? Die Angst vor einer zerstrittenen Partei, die im Kampf gegen die Republikaner jede Schwäche vermeiden will. Lieber folgt man still mit, als die eigene Position zu gefährden – ein Prinzip, das auch anderswo zu beobachten ist.
CDU/CSU: Die schweigende Masse hinter Merz und Söder
Ähnlich absurd geht es in Deutschland zu. Die Union, immer noch mit fast einer halben Million Mitglieder, hat sich offenbar kollektiv darauf geeinigt, ihrem Führungspersonal ohne Widerspruch zu folgen. Friedrich Merz, der politische Wiedergänger aus einer anderen Zeit, gefällt sich in der Rolle des konservativen Hardliners – und seine Anhänger folgen ihm, egal wie absurd seine Positionen sind. Dass er sich in seiner Bewunderung für Trump kaum zügeln kann und inhaltlich nicht einmal Mittelmaß liefert, scheint niemanden zu stören.
Markus Söder, einst der Meister der politischen Wankelmütigkeit, hat sich mittlerweile zum Karikatur seiner selbst entwickelt – und dennoch bleibt der innerparteiliche Aufschrei aus. Und dann sind da noch Figuren wie Alexander Dobrindt und Jens Spahn, die mit Steuergeld um sich werfen wie auf einer Kirmes, oder Julia Klöckner, deren Karriere ein einziges Lehrstück in Sachen Lobbyismus ist. Wo bleibt der Widerstand aus den eigenen Reihen?
SPD: Olaf Scholz und das große Vergessen
Und dann wäre da noch die SPD, die immerhin auf rund 360.000 Mitglieder kommt. Niemand scheint sich daran zu stören, dass Olaf Scholz in der Cum-Ex-Affäre eine erstaunliche Form der selektiven Amnesie entwickelt hat. Selbst als es offensichtlich wird, dass seine Erinnerungsfähigkeit erstaunlich oft aussetzt, bleibt die Partei still. Und Kevin Kühnert, einst lautstarker Kritiker der alten SPD-Seilschaften, ist im Ruhestand.
FDP: Im freien Fall und keiner sagt etwas
Ganz schlimm trifft es die FDP. Mit knapp 20.000 Mitgliedern ist sie ohnehin eher eine elitäre Selbsthilfegruppe als eine echte Volkspartei. Doch auch hier: Null Widerstand. Christian Lindner, selbstverliebter Wirtschaftsphilosoph ohne Fortune, macht eine Politik, die niemanden begeistert – außer vielleicht ihn selbst. Wolfgang Kubicki, mittlerweile eine Karikatur seiner selbst, liefert eine Peinlichkeit nach der anderen – und trotzdem rührt sich nichts in der Partei. Warum? Weil es einfacher ist, zu schweigen, als Verantwortung zu übernehmen.
Von Blockflöten zu Blockpfeifen?
Dieses blinde Gefolgschaftsverhalten erinnert erschreckend an das System der DDR-Volkskammer. Dort war Widerspruch nicht vorgesehen – und falls doch, hatte das Konsequenzen. Die sogenannten „Blockflöten“, also die Blockparteien, die der SED brav die Mauer machten, hatten keinerlei eigene Agenda. Heute scheinen viele Parteimitglieder in CDU, SPD und FDP ebenfalls zu reinen Abnickern verkommen zu sein – ohne Zwang, sondern aus Bequemlichkeit oder Opportunismus. Wer sich anpasst, kommt weiter, wer widerspricht, steht im Abseits. Das Prinzip hat sich seit der DDR kaum verändert, nur die Mechanismen sind subtiler geworden, auffallen tuen sie trotzdem.
Weimarer Verhältnisse – eine gefährliche Parallele?
Die Weimarer Republik gilt als warnendes Beispiel für eine Demokratie, die an internen Schwächen und fehlender Geschlossenheit zerbrach. Doch während sich damals extreme politische Lager unversöhnlich gegenüberstanden, erleben wir heute das Gegenteil: eine erschreckende Homogenität innerhalb der Parteien. Anstatt kontrovers zu debattieren, werden Führungspersonen selbst dann nicht infrage gestellt, wenn ihre Fehltritte offensichtlich sind.
Ein Beispiel aus der Weimarer Zeit zeigt, wohin das führen kann: Die Sozialdemokraten hielten trotz wachsender Probleme an einer unflexiblen Politik fest und verloren die Unterstützung der Arbeiterklasse. Gleichzeitig stellten sich die konservativen Parteien, anstatt aktiv Lösungen zu suchen, immer wieder hinter autoritäre Führungsfiguren wie Hindenburg, der schließlich Hitler den Weg ebnete. Die Parteien der Mitte waren paralysiert, während die Extremen erstarkten. Diese Muster – blinde Gefolgschaft, Angst vor interner Kritik und fehlender Mut zur Korrektur – sind heute in abgeschwächter Form wiederzuerkennen.
In Weimar führten Spaltung und Radikalisierung in den Untergang – heute könnte es die selbst auferlegte Gleichschaltung sein, die politische Innovation und dringend notwendige Reformen verhindert.
Warum sagen die Leute nichts?
Die Frage bleibt: Warum rebelliert keiner? Sind die Mitglieder wirklich so überzeugt? Glauben sie wirklich an die Führungsfiguren, die sie in die politische Bedeutungslosigkeit manövrieren? Oder ist es einfach Bequemlichkeit? Der Wunsch, nicht aufzufallen, nicht anzuecken?
Parteien brauchen Mitglieder, die denken, nicht nur nicken. Doch im Moment wirkt es eher so, als hätten sich die meisten längst entschieden: Brainswitch off – wir folgen einfach. Egal wohin.
Nachtrag: Ein Funke Hoffnung: Rückgrat beweist Widerstand
Inmitten dieser besorgniserregenden Entwicklung gibt es jedoch auch Lichtblicke. Einige mutige Mitglieder der CxU haben erkannt, dass Loyalität nicht Blindheit bedeuten darf. Sie haben den Mut gefunden, sich gegen den Strom zu stellen und die Partei zu verlassen, um ein Zeichen für ihre Überzeugungen zu setzen.
Diese Entscheidungen sind schmerzhaft, aber notwendig, um das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Sie zeigen, dass es noch Menschen mit Rückgrat gibt, die bereit sind, für ihre Werte einzustehen – selbst wenn dies bedeutet, ihre politische Karriere zu riskieren.
Es bleibt zu hoffen, dass diese Beispiele Schule machen und andere dazu ermutigen, ebenfalls ihre Stimme zu erheben. Denn nur durch offene Debatten und den Mut zur Kritik können Parteien wieder zu lebendigen Organisationen werden, die den Bedürfnissen der Bevölkerung dienen – und nicht umgekehrt.
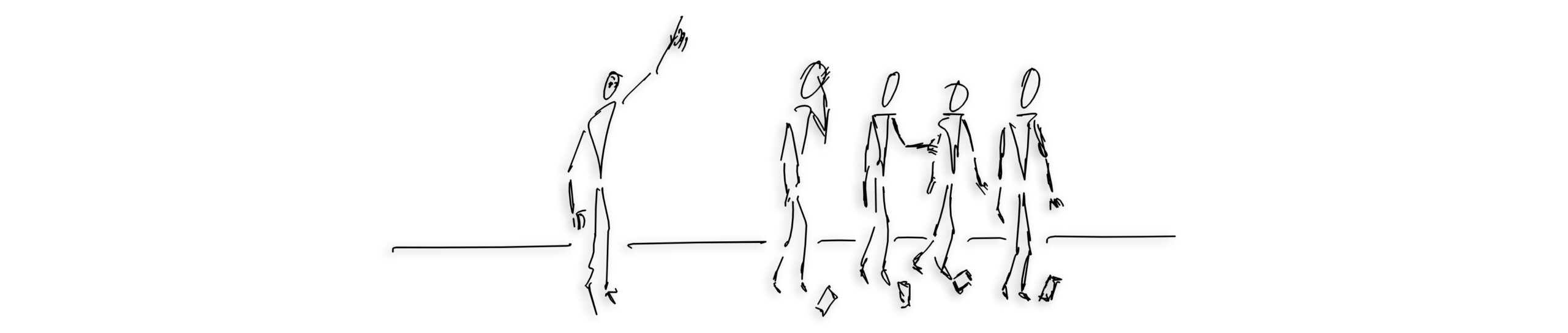
https://x.com/i/status/1903367356941824201