Wir leben in einer Welt, in der Konsum zum Grundrauschen geworden ist. Und dennoch, je mehr wir einkaufen, desto stärker schädigen wir Umwelt, Klima und letztlich auch unsere Zukunft. Eine paradoxe Logik: Unternehmen produzieren mehr, Verbraucher verlangen weniger zu bezahlen, die Politik vertraut auf Kennzahlen, die nicht selten Illusionen erzeugen. Am Ende steht die Überproduktion – eine zerstörerische Spirale, die längst nicht nur ökologische, sondern auch soziale Risiken birgt.
Der Preis der Gier nach billigen Produkten
Kaum ein Kunde betritt einen Laden, ohne dass er nach Sonderangeboten Ausschau hält. „Ein Euro günstiger!“ „50 % Rabatt!“ – der permanente Rabattmechanismus erzieht uns zur Erwartungshaltung, dass es morgen noch billiger wird und übermorgen noch mehr. Dieses Verhalten zwingt die Unternehmen dazu, ihre Margen immer weiter zu schrumpfen. Doch kostenfreie Preisnachlässe gibt es nicht. Irgendjemand zahlt den Preis – und zwar nicht nur der Produzent, sondern oft auch die Angestellten. Niedrigere Verkaufspreise münden zwangsläufig in sinkende Löhne und prekäre Arbeitsbedingungen.
Laut der International Labour Organization arbeiten weltweit über 160 Millionen Kinder in prekären Verhältnissen, ein Teil davon in den textilen Produktionsketten, die exakt auf diese Preisdrückerei ausgerichtet sind (ILO). Der „Geiz ist geil“-Reflex des Konsumenten mag kurzfristige individuelle Vorteile bringen, entpuppt sich aber als gesellschaftlicher Bumerang.
Moderner Jagd- und Spieltrieb als Antrieb für Rabattjagden
Der moderne Konsumzielfokus auf Rabattaktionen und Sonderangebote ist längst mehr als bloßes Sparen – er ist ein ausgeklügeltes Spiel mit dem menschlichen Jagd- und Spieltrieb. Dieser Urinstinkt, der uns einst half, in der Natur Beute zu machen, wird heute digital kanalisiert: Die Schnäppchenjagd wird zum spannungsgeladenen, emotionalen Erlebnis, das Glückshormone wie Dopamin ausschüttet und das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert.
Studien zeigen, dass beim Blick auf Rabattschilder oder limitierte Angebote das Gehirn ähnlich reagiert wie beim Gewinnen in einem Spiel oder beim Erlegen einer Beute. Die künstlich erzeugte Dringlichkeit, wie Zeitlimits und exklusive Member-Angebote, steigert die emotionale Erregung und fördert impulsives Kaufen, selbst wenn der tatsächliche Bedarf fehlt. Diese psychologische Konditionierung führt dazu, dass Kunden regelrecht darauf „trainiert“ werden, ständig auf das nächste „gute Geschäft“ zu lauern und dadurch in eine permanente Jagdmentalität verfallen (Rueetschli.net).
Diese spielerisch strukturierte Verführung funktioniert wie ein Konditionierungsmechanismus: Kunden lernen, Rabatte als Belohnung zu empfinden und entwickeln eine Erwartungshaltung, die sich nur schwer durchbrechen lässt. So entsteht ein Teufelskreis, in dem Kundenerwartungen an ständig sinkende Preise wachsen und gleichzeitig die Unternehmen noch aggressiver mit Rabattaktionen nachlegen müssen, um Aufmerksamkeit zu gewinnen.
Diese Entwicklung verstärkt die Überproduktion und die Spirale in die Umweltzerstörung, weil die Rabattschlachten nicht auf nachhaltigen Wert abzielen, sondern einzig auf kurzfristige, emotionale Kaufimpulse. Der moderne Konsument wird so in eine falsche Weise konditioniert, die nur auf schnelle Gewinne setzt und langfristige Folgen ignoriert.
Modellwechsel ohne echten Fortschritt
Die Märkte funktionieren längst nicht mehr über echten Innovationsdruck, sondern über künstlich geschaffene Rhythmen. Smartphones wechseln jedes Jahr in die nächste Modellgeneration – aber wo ist der Quantensprung in der Technologie, der das rechtfertigen würde? Meist sind es minimal verbesserte Kameralinsen, marginal schnellere Prozessoren oder eine kosmetische Änderung in der Bedienoberfläche. Der eigentliche technische Mehrwert bleibt gering, während die Marketingabteilungen Übertreibungen inszenieren, als hätten wir es mit einem „Revolutionsjahr“ zu tun.
Damit steht die Industrie vor einem Dilemma: Der Kunde verlangt nach Neuem, aber echtes Neues ist teuer. Also produziert man das Schein-Neue – und wälzt die Kosten der Überproduktion auf Umwelt und Gesellschaft ab. Kritische Stimmen, etwa vom Umweltbundesamt, warnen seit Jahren, dass der schnelle Produktwechsel in der Unterhaltungselektronik erhebliche CO₂-Belastungen verursacht (UBA).
Übervolle Regale – und die Theaterinszenierung der Rabattschlachten
In unseren Innenstädten und Online-Shops sehen wir die gleiche Szene immer wieder: Berge von Kleidung, Elektronik oder Spielzeug mit knalligen Rabattschildern. Black Friday, Mid-Season-Sale, „Heute alles 30 %“ – die Inszenierungen könnten kaum absurder sein. Die eigentliche Botschaft: Selbst die Händler wissen nicht mehr, wohin mit der Masse an Waren.
Nach Angaben der EU-Kommission landen jedes Jahr allein 5,8 Millionen Tonnen Textilien in der Altkleidersammlung oder direkt auf Deponien – zu großen Teilen ungetragen oder nur wenige Male benutzt (European Commission). Rabattschlachten sind weniger ein Kaufangebot, als vielmehr eine Beruhigungspille für die Unternehmen selbst, eine Methode, um einen Teil der Überproduktion zu kaschieren.
Der unstillbare Hunger nach Material und Energie
Je billiger die Produkte, desto höher die Produktionszahlen, desto größer der Material- und Energieaufwand. In jedem Smartphone stecken seltene Erden wie Neodym, Indium oder Kobalt, deren Förderung ganze Ökosysteme zerstört und soziale Konflikte anheizt – insbesondere im globalen Süden ( Bonn International Center for Conflict Studies).
Dazu kommt: Auch Energie wächst nicht auf Bäumen. Die Energiewirtschaft verzeichnet seit Jahren steigende globale Verbrauchswerte, angetrieben durch genau jene Überproduktion, die weder ökologisch noch technisch rational begründbar ist. Wenn ein Fernsehgerät jede Saison ein kleines Stückchen billiger wird, zahlen dafür Klima und Umwelt den Preis.
Müllberge ohne Ende
Produkte, die niemand gebraucht hätte, landen früher oder später im Müll. Die globale Abfallwirtschaft wird zur stillen Verliererin der Konsumexzesse. Allein im Bereich Elektroschrott entstehen jährlich weltweit mehr als 50 Millionen Tonnen Abfälle, von denen laut WEEE Forum weniger als 20 % offiziell recycelt werden. Der Rest landet in Deponien, wird exportiert und oft illegal verbrannt – mit massiven Folgen für Boden, Luft und Wasser.
Die Abfallberge wachsen, nicht weil wir sie nicht technisch verwalten könnten, sondern weil die Dynamik der Überproduktion immer neue Mengen hervorbringt. Solange Ware im Überfluss produziert wird, suchen wir am Ende händeringend nach Deponien – statt die Quelle des Problems anzupacken.
Geplante Obsoleszenz – der eingebaute Ablaufplan
Dass Produkte absichtlich mit kürzerer Lebenszeit konstruiert werden, ist kein Mythos, sondern gelebte Strategie. Ob nicht austauschbare Akkus, fragile Kunststoffteile oder unersetzbare Bauelemente: Unternehmen designen Produkte so, dass der Konsument nach Ablauf einer bestimmten Zeit gezwungen wird, ein neues Produkt zu kaufen.
Diese Praxis wird sogar wissenschaftlich untermauert. Eine Studie der Öko-Institut e.V. stellte 2016 fest, dass die Lebensdauer vieler Elektrogeräte im Schnitt deutlich sinkt, insbesondere im Bereich Haushaltsgeräte. Ein Kühlschrank hält nicht mehr 15 Jahre wie einst, sondern oft nur noch 7 bis 10. Das ist kein technischer Fortschritt – es ist eine ökonomische Farce.
Falsche Kennzahlen als Leitplanken
Unsere Wirtschaft bewertet ihren Erfolg vor allem über das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Doch dieses Maß feiert auch Katastrophen als „Wachstum“, wenn mehr Ressourcen zerstört und neu angeschafft werden. Es misst nicht Nachhaltigkeit, nicht Wohlergehen, sondern nur ökonomische Aktivität – egal ob sinnvoll oder schädlich.
Kritiker fordern deshalb Alternativen wie den „Genuine Progress Indicator“ (GPI) oder die Umstellung auf Wohlstandsindikatoren, die ökologische und soziale Dimensionen erfassen. Doch Politik und Unternehmen verharren oft in der Illusion, dass Zahlen, die mehr Umsatz und mehr Produktion reflektieren, automatisch gutes Management darstellen.
Nachhaltigkeit – nur ein Marketing-Schlagwort?
Die Inflation des Begriffs „nachhaltig“ ist auffällig. Kaum ein Konzern verzichtet auf den wohlklingenden Slogan. Doch oft bleibt es bei kosmetischen Maßnahmen: Ein grünes Logo hier, eine Papiertüte dort. Der Kernprozess bleibt derselbe – Überproduktion, Absatzdruck, Rabattschlachten.
Nachhaltigkeit wird damit zur PR-Verkleidung und nicht zur Strategie. Studien der Global Reporting Initiative zeigen, dass viele Unternehmen zwar Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen, jedoch kaum reale Veränderungen in Lieferketten, Produktionsmengen oder Recyclingquoten vornehmen. Eine nachhaltige Strategie würde aber genau an diesen Punkten ansetzen: weniger produzieren, langlebigere Produkte entwickeln, faire Preise zahlen.
Das Ende der Spirale
Preisfindung bei Überproduktion ist keine Frage betriebswirtschaftlicher Raffinesse, sondern das Symptom einer kranken Systemlogik. Konsumenten, die immer noch mehr für weniger wollen, Unternehmen, die um jeden Absatz kämpfen, und eine Politik, die Wachstum mit Wohlstand verwechselt – gemeinsam drehen sie das Rad in eine Richtung, an deren Ende das Umweltdesaster steht.
Die Alternative ist nicht utopisch: Produkte länger nutzen, weniger kaufen, Reparatur statt Neukauf, klare politische Regeln gegen geplante Obsoleszenz und faire Preise für faire Arbeit. Erst wenn wir begreifen, dass der niedrigste Preis oft den höchsten Schaden verursacht, werden wir der Spirale ernsthaft entkommen.

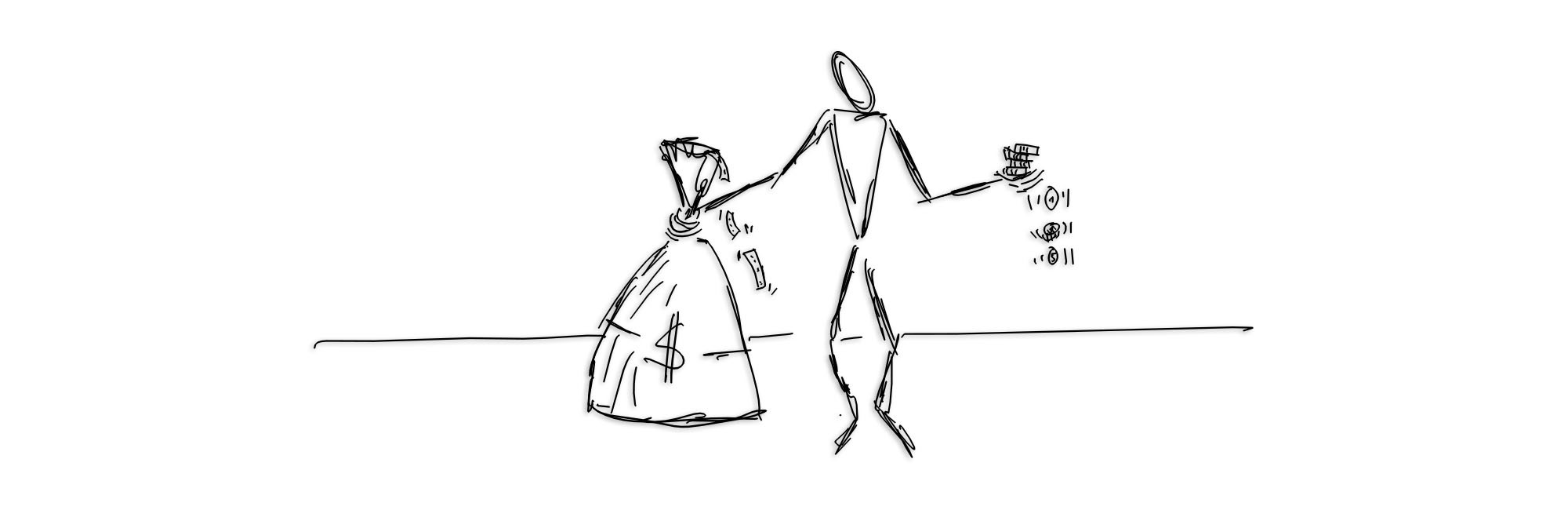
Guten Abend, ich weiß nicht, wie lange dieses Betrügen und Belügen schon funktioniert???
Ob politsch oder in der Werbebranche…
im 8. Gebot in der Bibel ist schon das Lügen erwähnt.
Und leider sehen zu viele Menschen nur den eigenen Vorteil, nie den Schaden anderer oder der Natur.
Besonders diese Distanz zwischen Aktionären (Aktive …) und Produkt und Kunden durch Handeln von Firmenaktien an der Börse macht jedes Verantwortungsbewusstsein fast unmöglich.
Bei über 160 Millionen Kinderarbeitern – doppelt soviel wie Deutschland Einwohner hat – ist ein Umdenken nicht mehr möglich ohne explosionsartige Naturbedrohung, wie z.B. Verlust von Trinkwasser.
Wenn sich eine solche Katastrophe nicht nur andeuted, sondern da ist, das täglich millionen Menschen verdursten, dann könnte ein Umdenken mit der nötigen Geschwindigkeit passieren. Sonst nicht mit der nötigen Geschwindigkeit! Was nützen in Deutschland 10.000 Naturschützer mit Nachhaltigkeitsdenken, wenn fast drei Milliarden Menschen (Inder und Chinesen) davon leben, satt werden, das wir den Müll kaufen?!
LG Wolfgang Hubrach
Stimmt. Die Lüge ist omnipräsent. Leider. Vielleicht schafft es ja ein neuer Messias – ein Jesus Marx, die Ordnung wieder zu korrigieren? Vielleicht braucht es den Wahrheitsindex als gesetzliche Grundlage?