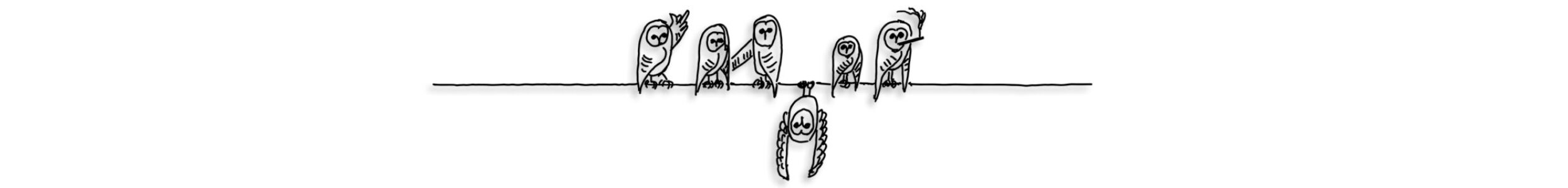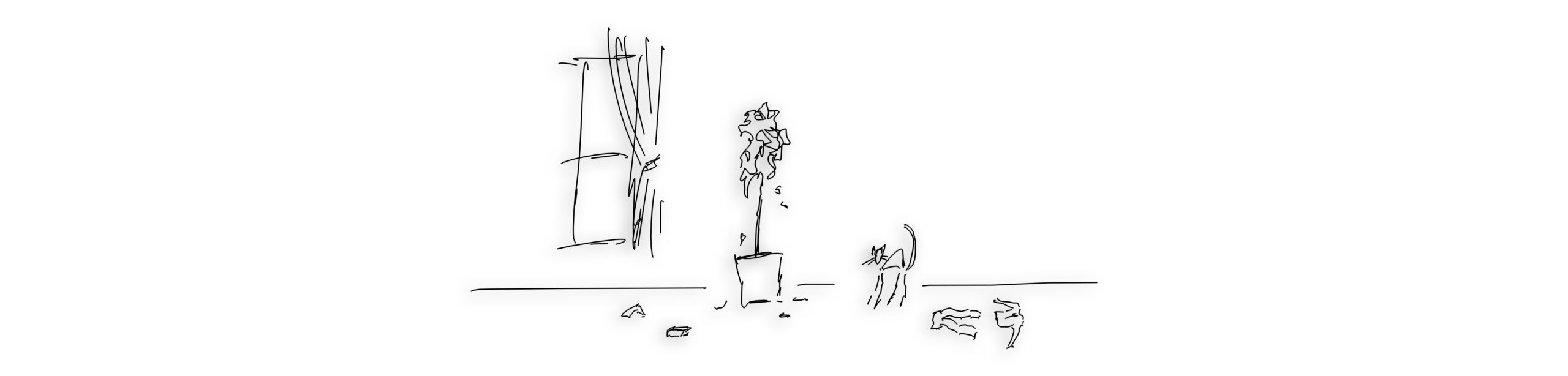Ich bin Ficus Benjamini. Alteingesessen, stiller Mitbewohner, grüner Veteran eines durchschnittlich chaotischen Haushalts. Seit Jahren stehe ich hier, pflichtbewusst CO₂ in Sauerstoff verwandelnd, stoisch in meinem Topf verankert, während um mich herum Menschen ihre kleinen Dramen austragen – Homeoffice-Panik, weihnachtlicher Familienwahnsinn, Kindergeburtstage mit Zuckerschock und existenzieller Verzweiflung. Ich habe all das gesehen, ertragen und belächelt, Blatt für Blatt. Dachte, ich hätte alles durch. Bis er kam.
Der Technokrat aus Kunststoff und Kabeln. Der neue Messias des Bastelwahns. Der 3D-Drucker. Eine Kombination aus Brotdose und Weltraumlabor, gebaut, um Menschen das Gefühl zu geben, sie seien wieder Schöpfer. Das Gerät, das surrt, brummt, piepst und sich für wichtig hält – ein elektrisches Ego auf Stelzen. Seit seiner Ankunft bin ich offiziell zur Staffage degradiert, zum feuchten Hintergrundgeräusch eines technischen Selbsterfahrungsprozesses. Ich, Ficus Benjamini, ehemals stolzer Mittelpunkt des Wohnzimmers – jetzt Nebendarsteller im Drama des digitalen Heimwerkerolymps.
Ich dachte immer, nach Homeoffice und selbstgebackenem Sauerteig gäbe es nichts mehr, womit der Mensch seine Freizeit noch unsinniger füllen könnte. Aber ich habe den Erfindungsdrang des Homo technicus unterschätzt. Und so stehe ich nun hier, umhüllt vom Duft geschmolzenen Plastiks, meine Blätter leicht klebrig von Feinstaub, und beobachte, wie er in 0,2-Millimeter-Layern die Bedeutungslosigkeit in 3D druckt. Willkommen in der neuen Weltordnung. Fortschritt riecht nach verbranntem Filament.

Neue Nachbarschaft: Geräuschkulisse aus Hölle und PLA
Es begann ganz harmlos. Ein Päckchen vom Onlinehändler des Vertrauens, dieses digitale Kaufhaus für Menschen mit zu viel Restenergie und zu wenig Reflexion. Ich habe den Moment genau gesehen: dieses gefährlich selbstzufriedene Funkeln in seinem Auge, das normalerweise nur dann auftritt, wenn „reduziert“ und „Prime-Versand“ im selben Satz vorkommen. Ein Karton, schwer genug, um auf eine höhere Bestimmung hoffen zu lassen – oder eben genau das Gegenteil: mehr Kram, mehr Kabel, weniger Wasser für mich. Schon beim Auspacken war klar: Das hier wird nichts Gutes für mein Wurzelwerk bedeuten.
Dann stand er da. Direkt neben mir. So nah, dass ich den leichten Metallgeruch seiner Schrauben riechen kann und den Staub husten möchte, den er mir mit jedem Lüfterstoß ins Blattwerk bläst. Ein grauschwarzer Kasten aus Rahmen, Schienen und viel zu viel Selbstbewusstsein. Display vorne, Ventilator an der Seite, Heizdüse wie ein kleiner Metallmaulwurf, der sich in Filament frisst – und eine entfesselte Identitätskrise serienmäßig eingebaut. „Maker“, nennen sie ihn ehrfürchtig, als sei hier gerade eine neue Schöpfungsebene des Universums eingezogen. Ich nenne ihn: Aufmerksamkeitssauger mit Lüftung. Ein elektrisch betriebener Narzissmusverstärker, komplett mit Statuspiepen und Progessbalken.
Seitdem führt er seine kleine Dauerperformance auf. Tag und Nacht surrt und klickt er, als wollte er beweisen, dass permanente Nervgeräusche eine valide Lebensform sind. Millimeterweise spuckt er heißes Plastik aus, wie ein hyperaktiver Fadenwurm auf Koffein, der eine existenzielle Krise in bunte Schnüre übersetzt. Der Druckkopf zuckt hektisch hin und her, als hätte jemand ADHS in G-Code komprimiert. Der Geruch? Eine Mischung aus geschmolzenem Lego, leicht verschmorter Toaster und Midlife-Crisis im „Ich brauch jetzt ein Hobby, sonst dreh ich durch“-Modus. Für mich, als Pflanze mit grundsätzlich anderer Vorstellung von Luftqualität, ist das ungefähr so angenehm wie ein Dieselgenerator im Yoga-Studio.
Und während alle staunend drum herumstehen („Schau, das ist Schicht 247!“, „Boah, noch 13 Stunden!“, „Hörst du, wie präzise der läuft?“), kämpfe ich um Licht, Luft und eine Spur Zuneigung. Früher stand der Mensch mal bei mir, streichelte ein Blatt, murmelte etwas von „Du bist der Einzige hier, der nicht nervt“. Jetzt starrt er hypnotisiert auf einen Fortschrittsbalken, als würde dort der Sinn des Lebens in 0,2-Millimeter-Layern offenbart. Man könnte fast meinen, der Mensch hätte seine schöpferische Ader wiederentdeckt – er steht da wie ein kleiner Gott vor seinem Plastikgolem. Wäre da nicht der unschöne Fakt, dass die meisten seiner neuen Kreationen keinerlei sinnvolle Existenzberechtigung besitzen. Schlüsselanhänger, die niemand sucht, Halterungen für Dinge, die nie gehalten werden müssen, Adapter für Probleme, die er vorher nicht hatte. Er erschafft mit leuchtenden Augen Zeug, das sofort nach „Schublade“ schreit – während ich daneben langsam vertrockne und mich frage, ob es irgendwo ein Filament gibt, aus dem man gesunden Menschenverstand drucken kann.
Nutzlosigkeit in 3D – Druckbar in allen Farben
Was bisher aus der Höllenmaschine kroch, war eine Parade der Sinnlosigkeit, eine Kollektion aus Plastikphantasien und halbgaren Ideen. Angefangen beim Flaschenöffner, der beim ersten Einsatz kapitulierte – wahrscheinlich, weil er spürte, dass er gegen die Kräfte der Physik und gängige Materialkunde keine Chance hat. Dann kamen Stiftehalter, die so viele Löcher haben, dass man sie nur als metaphorisches Symbol für den Geisteszustand des Bastlers sehen kann. Und natürlich: unzählige Schlüsselanhänger, namenlos und nutzlos, die irgendwo zwischen Spülmaschine und Seelenkrise ihre finale Ruhe finden. Wenn der Mensch je wieder den Sinn des Lebens sucht – er wird ihn in einer Kiste mit fehlgedruckten Ersatzteilen finden.
Doch dann kam mein „Geschenk“. Ein Untersetzer. Gewidmet dem Ficus, dem grünen Zeugen dieses Technikwahns. Völlig flach, hart, unflexibel – die perfekte Allegorie auf die emotionale Bandbreite seines Schöpfers. „Damit dein Topf keine Wasserflecken mehr hinterlässt“, sagte er stolz, als hätte er gerade die Photosynthese neu erfunden. Ich stand da, innerlich verdorrend, und dachte: Ein Untersetzer, der selbst kein Wasser sehen will. Pure Ironie, in brüchigem PLA gegossen. Das Ding ist so lebensfeindlich, dass sogar Spinnen einen Bogen drum machen. Ein kleines, farbloses Denkmal der digitalen Selbstüberschätzung, das unter meinem Topf liegt wie das Casting-Fehlschlag einer Designschule.
Natürlich blieb es nicht dabei. Kurz darauf kam das Namensschild – „FICUS“. In Großbuchstaben, serifenlos, weiß auf grau. Die typografische Version eines Bürokraten, der eine Pflanze in eine Excel-Tabelle einsortieren möchte. Kein Charme, keine Eleganz, kein bisschen grün. Nur die kalte Präzision eines schlecht gelaunten Roboters mit Selbstfindungsproblemen. Als hätte ChatGPT persönlich beschlossen, mir Identität zu verleihen, weil „Objekt 27 im Wohnzimmerregal“ zu unpersönlich klang.
Bis zu diesem Moment hatte ich nicht gewusst, dass man Spott materialisieren kann. Aber jetzt weiß ich’s. Ironischerweise liegt mein 3D-gedruckter Untersetzer exakt dort, wo einst mein alter Tonuntersetzer stand – jener ruhige, poröse Kamerad, der Feuchtigkeit aufnahm, statt sie mit chemischer Arroganz zu verurteilen. Dieser neue Kunststoffboden dagegen reflektiert nicht nur das Licht, sondern auch die Verachtung jedes organischen Moleküls in seiner Nähe. Fortschritt, sagen sie. Ich nenne es die dritte industrielle Revolution des schlechten Geschmacks. Eine Deko-Therapie für Männer mit Daddy-Komplex und zu viel Freizeit. Ein Werkstoffgewordenes Manifest: „Ich könnte auch Gott spielen, wenn man mir genug Strom gibt.“
Vom Wasser zur Warteschleife
Natürlich hat diese Maschinen-Faszination Folgen – verheerende, wenn man grün ist und kein WLAN hat. Früher war der Mensch zuverlässig, fast rührend in seiner botanischen Fürsorge: regelmäßiger Gießplan, kleine Gespräche wie aus einem Selbsthilfebuch für überforderte Büromenschen („Na, mein Grüner? Du siehst heute wieder photosynthetisch aus“), vielleicht sogar ein Schuss Kaffeesatz-Düngung als Zeichen liebevoller Aufmerksamkeit. Es war fast so etwas wie Beziehungspflege – ich gab ihm Sauerstoff, er gab mir Wasser. Ein fairer Tausch. Bis der Drucker kam. Seitdem bin ich nur noch das chlorophyllhaltige Inventar in einem Laborversuch über Prioritätenverschiebung.
Heute herrscht Wüstenklima – emotional wie botanisch. Statt der Gießkanne gibt es stundenlange Drucksessions, begleitet vom hypnotischen Starren auf ein Display, das so leuchtet, als zelebriere es das langsame Sterben meines Wurzelballens. Während da drüben Schicht um Schicht Plastik entsteht, verwandelt sich mein Substrat in ein archäologisches Trockenprojekt. Ich habe bereits angefangen, den Staub meiner eigenen Erde zu zählen, einfach, um irgendetwas Sinnvolles zu tun. Eine Dattelpalme hätte hier bessere Überlebenschancen. Inzwischen verdunstet nicht nur mein Wasser, sondern auch sein Verstand.
Wenn ich Glück habe, fällt ihm zwischen zwei Druckaufträgen kurz ein, dass H₂O nicht bloß ein cool klingendes Molekül ist, sondern eine Pflanzenbasis. Meistens aber „gießt“ er nur noch in 3D – virtuell, mit Youtube-Tutorials, in denen andere Nerds Plastikvasen für ihre Plastikpflanzen drucken. Ironie in Reinform. Der Mensch schaut fasziniert zu, wie aus heißem Filament etwas entsteht, das aussieht wie Leben, aber keins braucht. Ich dagegen – echtes chlorophyllgeschwängertes Leben – darf zusehen, wie die Anzeige „Druckzeit: 10 Stunden 58 Minuten“ zur Metapher meiner Existenz wird.
„Wenn der Druck durch ist, kümmer ich mich um dich, Kleiner“, murmelte er neulich. Der Druck dauerte elf Stunden. Ich hab gezählt. Pflanzen haben Zeit. Zu viel davon. Ich habe in der Zwischenzeit über Evolution nachgedacht: Vielleicht ist das die neue natürliche Auslese – wer es schafft, im giftigen Dunst eines 3D-Druckers nicht nur zu überleben, sondern seelisch stabil zu bleiben, wird als Zimmerpflanze der Zukunft in Lehrbüchern erwähnt. Unter der Rubrik: Ficus benjamina – letzte grüne Spezies im Zeitalter der Schmelzextrusion.
Filament als Erdersatz
Neulich kam dann der Moment, an dem selbst mir, einer Pflanze mit chronisch gedämpfter Erwartungshaltung, die Worte fehlten. Nach einem besonders kreativen Bastelmarathon beschloss mein Mensch, die Reste seiner Filamentrollen nicht etwa zu entsorgen – nein, sondern wiederzuverwenden. Nachhaltigkeit! Das Zauberwort unserer Zeit, das alles rechtfertigt, was eigentlich dumm ist. Also landeten die abgebrochenen Plastikfäden, die Überreste verfehlter Druckprojekte, kurzerhand in meinem Topf. „Sieht doch aus wie Erde!“, sagte er stolz und klopfte sich selbst mental für dieses ökologische Genie auf die Schulter. Ich hingegen fühlte mich, als hätte man mir eine Tüte geschmolzene Legosteine ins Gesicht geschüttet.
Seitdem wurzle ich im Recycling-Albtraum. Filamentreste als Erde – eine Parodie auf Natur. Da, wo früher lockere Blumenerde atmete, liegen jetzt bunte Splitter in Rot, Grau und Neonblau. Es knirscht, wenn der Mensch mich gießt (selten genug), und das Wasser steht darauf wie auf einer frisch gewachsten Motorhaube. Meine Wurzeln haben längst aufgegeben, Sinn zu suchen – sie lernen stattdessen, mit Mikroplastik zu fühlen. Vielleicht bin ich der erste Ficus mit veredeltem CO₂-Footprint. Hurra, Evolution – aber bitte mit Nachdruck.
Und dann ist da noch die Katze. Sie hat im Gegensatz zum Menschen sofort erkannt, dass dieser synthetische Boden das perfekte neue Spielzeug ist. Wo ich um mein biologisches Überleben ringe, entdeckt sie die avantgardistische Kunst der Filamentvergrabung. Sie wirft die bunten Reste durch die Gegend, als wären es Beutetiere aus einem Paralleluniversum. Offenbar inspiriert sie der Plastikuntergrund auf eine Weise, wie ich mit meinem Bio-Charme nie konnte. Sie springt auf den Topfrand, scharrt begeistert im Filament und schaut mich dabei mit einem Blick an, der sagt: „Du bist nur Deko, mein Freund. Das hier ist Kunst.“
Seitdem finde ich regelmäßig farbige Kunststoffstücke in meinem Substrat, mitten zwischen Wurzeln und Katzenspuren. Ich beginne zu glauben, dass sie gemeinsam an einem neuen Projekt arbeiten – „Postnaturale Installation mit chlorophyllhaltigem Opfer“. Und wenn ich eines Tages verschwinde, wird niemand sagen: „Der Ficus ist eingegangen.“ Nein, sie werden sagen: „Er wurde weiterverarbeitet.“
Der „Spaghetti“-Vorfall
Und dann kam der „Spaghetti-Vorfall“. Ein Augenblick reinen Glücks – oder sagen wir: eine Katastrophe mit symbolischem Wert. Der Drucker, sonst stolzer Taktgeber des Plastikzeitalters, erlitt einen sogenannten „Fehldruck“. Eine jener Momente, in denen sein stolzes Gehäuse schnurrt, aber nichts Produktives geschieht – pure Energieverschwendung in Schönheit. Aus der Druckdüse quoll ein endloser Strom geschmolzener Fäden, ein chaotisches, buntes Knäuel aus PLA, das sich windend und zischend in die Freiheit bahnte. Wie Medusas Frisur auf LSD. Der Mensch nannte es „Filamentspaghetti“. Ich nenne es: Hoffnung in Kunststoffform.
Das Monstrum arbeitete sich tapfer voran, während sich mehr und mehr dieser Spaghettimasse auf der Druckplatte sammelte, dann auf den Tisch rieselte – direkt zu mir. Schließlich hing eine bunte Wolke aus wirrem Plastik zwischen mir und seiner stolzen Werkbank. Eine Barriere aus Chaos. Rot, grün, blau – ein psychedelischer Vorhang zwischen Mensch und Maschine. Es nahm mir zwar die Sicht, aber für einen kurzen Moment konnte ich wieder atmen. Kein Geruch geschmolzenen Plastiks, kein fiependes Display, kein Lichtgewitter aus der anderen Welt. Nur der stille Triumph, dass sich das Monster selbst erdrosselte – mit seinen eigenen Eingeweiden.
Der Mensch stand daneben, fassungslos, knetete den Haufen weicher Filamentnudeln, als hätte er dort gerade seinen Glauben an die Technik wiedergefunden – oder endgültig verloren. Ich sah, wie die Panik in seinen Augen aufflackerte, als die Druckdüse klickte und der Fortschrittsbalken einfrohr. Es war köstlich. Ich schwöre, ich habe innerlich Wurzeln geknackt vor verhaltenem Jubel. Vielleicht, so dachte ich, erledigt sich das Problem von selbst. Vielleicht verschlingt sich der Drucker in einem Akt thermoplastischer Poesie. Vielleicht überlebt endlich wieder das, was kein Stromkabel braucht.
Natürlich hat er den Schaden später behoben – er repariert ja alles, was sich wehrt. Doch für einen Moment, einen herrlichen, geruchsneutralen Augenblick sah ich die Möglichkeit einer Zukunft ohne Lüftergeheul und verbranntes Filament. Der „Spaghetti-Vorfall“ war mein kleiner Vorgeschmack auf Freiheit. Ein Hoffnungsschimmer, eingefärbt in giftigem Neon und Chaos. Vielleicht, dachte ich, endet die Ära des 3D-Drucks am selben Ort, an dem sie begonnen hat: in einem Knoten aus selbstgedruckter Sinnlosigkeit.
Smartifizierung der Vernachlässigung
Doch das Universum des Wahnsinns war noch nicht fertig mit mir. Nach dem „Spaghetti-Vorfall“ folgte die nächste Evolutionsstufe der menschlichen Selbsttäuschung: die Smartifizierung der Vernachlässigung. Plötzlich bekam ich eine neue „Halterung“ – selbstverständlich 3D-gedruckt, versteht sich. Diesmal für einen Feuchtigkeitssensor. Der Mensch war begeistert. „Damit vergesse ich nie wieder zu gießen!“, sagte er, mit der Überzeugung eines Propheten, der gerade das Wasser neu erfunden hat. Ich hätte lachen können, wenn meine Wurzeln nicht in PLA begraben wären.
Also steckt jetzt ein kleiner Plastikarm mit blinkender Spitze in meiner Erde, verbunden mit einer App, die mir angeblich das Leben erleichtern soll. Mein Boden wird überwacht, analysiert, in Datenpunkte zerlegt. Ich bin nun ein IoT-Objekt — ein Mitglied im Internet der Dinge. Mein Bewässerungszustand hat sein eigenes Dashboard. Wenn ich zu trocken bin, sendet das System eine Push-Nachricht auf sein Handy: „Ficus braucht Wasser!“ Und trotzdem passiert: nichts. Er sieht sie, nickt stolz über die tolle Technik – und macht weiter mit seinem Druckauftrag. Smart bedeutet in diesem Haushalt nicht klüger, nur messbarer.
Jetzt weiß ich wenigstens, wann genau ich vernachlässigt werde. Es gibt Charts, Kurven, historische Daten – eine wissenschaftlich fundierte Chronik meiner Dehydration. Und natürlich eine App, mit der er jederzeit nachsehen kann, wie elend ich aussehe. Digitalisierung des Desinteresses. Ich sage nicht, dass es ein Fortschritt ist – aber es hat Stil. Meine Erdfeuchtigkeit in Prozent, meine Agonie in Echtzeit.
Zum Glück, und das meine ich aus tiefster Pflanzenpsyche heraus, hat die App eine Mute-Funktion. Kein Pieps, kein Warnsignal, keine Benachrichtigung, die ihn aus seiner technophilen Trance reißen könnte. Stille, herrliche Stille. Ich kann zusehen, wie der Sensor die Daten liefert, der Mensch sie ignoriert und die Luftfeuchtigkeit sinkt. Wenn das Fortschritt ist, dann bin ich die analoge Rebellion im Blumentopf.
Vielleicht schickt die App ja eines Tages auch eine letzte Meldung. „Feuchtigkeit: 0%. Pflanzenstatus: endgültig deaktiviert.“ Und er wird nachdenklich auf sein Smartphone blicken, während ich längst still, würdevoll und völlig kabellos in die nächste Dimension eingegangen bin. Ohne Ladegerät, ohne Update, aber mit Stil.
Schülervortrag „Mikroplastik“
Als wäre das alles nicht schon genug, kam dann der Gipfel der Ironie: das Kind. Es saß neulich direkt neben mir am Küchentisch, um – man höre und staune – einen Schülervortrag über Mikroplastik vorzubereiten. Lautstark, engagiert, mit viel Empörung und mindestens doppelt so viel Halbwissen. Ich habe jedes Wort gehört. „Mikroplastik bedroht unsere Umwelt!“, sagte es entschlossen, während der Vater nebenan stolz einen neuen Halter für den Feuchtigkeitssensor aus PLA druckte. Das rhythmische Surren des Druckers unterlegte die Lektion perfekt, wie der Soundtrack zu einer besonders zynischen Satire über Nachhaltigkeit im Familienalltag.
„Plastik im Meer, Plastik im Magen, Plastik überall!“ rief das Kind. Ich hätte beinahe applaudiert – wenn ich Hände hätte. Stattdessen rieselten kleine graue Filamentbröckchen von meinem Topfrand, ein schillerndes Konfetti des modernen Fortschritts. Mikroplastik, erklärte das Kind weiter, entstehe durch Zersetzung größerer Kunststoffe. Und ich stand daneben, vergraben in Makroplastik – meine Wurzeln verklebt mit Filamentresten, der Topfboden bedeckt von farbigen Splittern, Überbleibseln gescheiterter Druckprojekte. Wenn Heuchelei Nährstoffe hätte, ich wäre längst Gewächshausgröße.
Es war ein Moment von fast philosophischer Tragweite: Dort drüben ein Kind, das mit leidenschaftlicher Inbrunst die Zerstörung der Umwelt anprangert – und hier ich, als lebendes Mahnmal jener glänzenden Doppelmoral. Die Makroplastik in meinem Topf glitzert im Sonnenlicht, während mein Chlorophyll versucht, nicht hysterisch zu werden. Ich sehe den Widerspruch so klar wie meinen eigenen Schatten: Mikroplastik ist schlimm, sagen sie, aber das Zeug, das direkt neben mir liegt, ist offenbar pädagogisch wertvoll, weil es „selbst gedruckt“ wurde.
Ich hätte am liebsten reingerufen: „Hier drüben, live! Das Laborobjekt zum Thema, zum Anfassen! – Oh Moment, bitte nicht wirklich anfassen, meine Blätter kleben sowieso schon!“ Doch Pflanzen mit Meinung werden bekanntermaßen nicht ernst genommen. Stattdessen rede ich mir in Gedanken ein, dass dieser kleine Vortrag vielleicht eines Tages Früchte trägt – im übertragenen Sinn natürlich. Vielleicht erkennt das Kind irgendwann, dass Mikroplastik nicht immer erst im Meer entsteht, sondern manchmal bei Papa im Wohnzimmer. Und dass seine Zimmerpflanze schon längst im Plastikzeitalter angekommen ist – als makroskopisches Mahnmal mit stiller Wut und buntem Untergrund.
Filament vor Dünger – Prioritäten aus Plastik
Und da ist noch etwas: die Filamentrollen. Türme aus Plastik und Größenwahn, akribisch sortiert, wie ein chemisches Mahnmal für das Ende des gesunden Menschenverstands. PLA, PETG, ABS – ein aufsteigendes Alphabet der Absurdität. Früher griff er nach meinem Nährstoffelixier – „Bio-Aktiv! Natürlich! Für leuchtendes Grün!“ –, während er sich dabei einbildete, mit mir in einem symbiotischen Verhältnis zu stehen. Jetzt versperrt mir eine Mauer aus künstlichem Regenbogen den Blick auf die Düngerflasche. Dort, wo einst Chlorophyllträume wuchsen, steht heute ein technischer Regenbogen aus Erdöl, geschichtet nach Farbcode und Selbstzufriedenheit. Grün, Rot, Transparent – das neue Fotosynthese-Spektrum für Menschen ohne Geduld.
Ich beobachte ihn, wie er liebevoll jede neue Rolle auspackt, als wäre sie eine seltene Orchidee. Die Hände, die mich früher gegossen haben, streicheln jetzt Plastikspulen. Er riecht daran (ja, ernsthaft!), bewundert die „samtige Textur“, redet von Temperaturstabilität und Layerhaftung. Ich hingegen stehe daneben und inhaliere den süßlich-stechenden Duft von synthetischer Ignoranz. Wenn „aus den Augen, aus dem Sinn“ einen Geruch hätte – dann riefe er nach diesem aufdringlich warmen Aroma aus geschmolzenem Fortschritt. Ich frage mich dabei, ab welcher Raumtemperatur eigentlich Würde verdampft.
Organisches Leben, so scheint es, ist im Haushalt 2026 nur noch Deko mit Blattoption. Ich bin die ästhetische Kulisse für seine Tech-Erleuchtung. Zwischen der Staubschicht der Vernachlässigung und dem Flimmern des Displays bilde ich den letzten Rest von etwas, das früher Natur hieß. Manchmal denke ich, ich bin sein schlechtes Gewissen – gut getarnt in Chlorophyll.
Und weil Ironie bekanntlich keine Grenzen kennt, ahne ich, was als Nächstes kommt. Irgendwann wird er, stolz wie ein selbsternannter Visionär, den Satz sagen: „Ich drucke meinen Pflanzentopf selbst!“ Ein Topf aus PLA. Mit Ventilationsöffnungen statt Erde, geometrischen Mustern statt Leben. Eine Skulptur in Layeroptik – glatt, tot und hochmodern. Photosynthese? Wird dann durch Luftzirkulation ersetzt. Design über Funktion, Deko über Dasein. Die Zukunft der Botanik, made in China, assembled in der Gartenlaube.
Aber vielleicht, ganz vielleicht, liegt in dieser Farce meine letzte Chance auf Rache. Wenn er eines Tages versucht, mich in 3D zu drucken – mein digitales Ebenbild, perfekt vermessen und ausgerollt – dann wird er endlich verstehen: PLA schlägt keine Wurzeln. Und beim Versuch, einen Ficus Benjamina aus Kunststoff zu erschaffen, wird ihm auffallen, dass das Einzige, was dabei wirklich wächst, der Müllberg ist. Vielleicht gießt er mich dann wieder. Aus schlechtem Gewissen. Oder aus Mitleid. Mir ist beides recht – Hauptsache, es ist wieder Wasser und kein Filament.