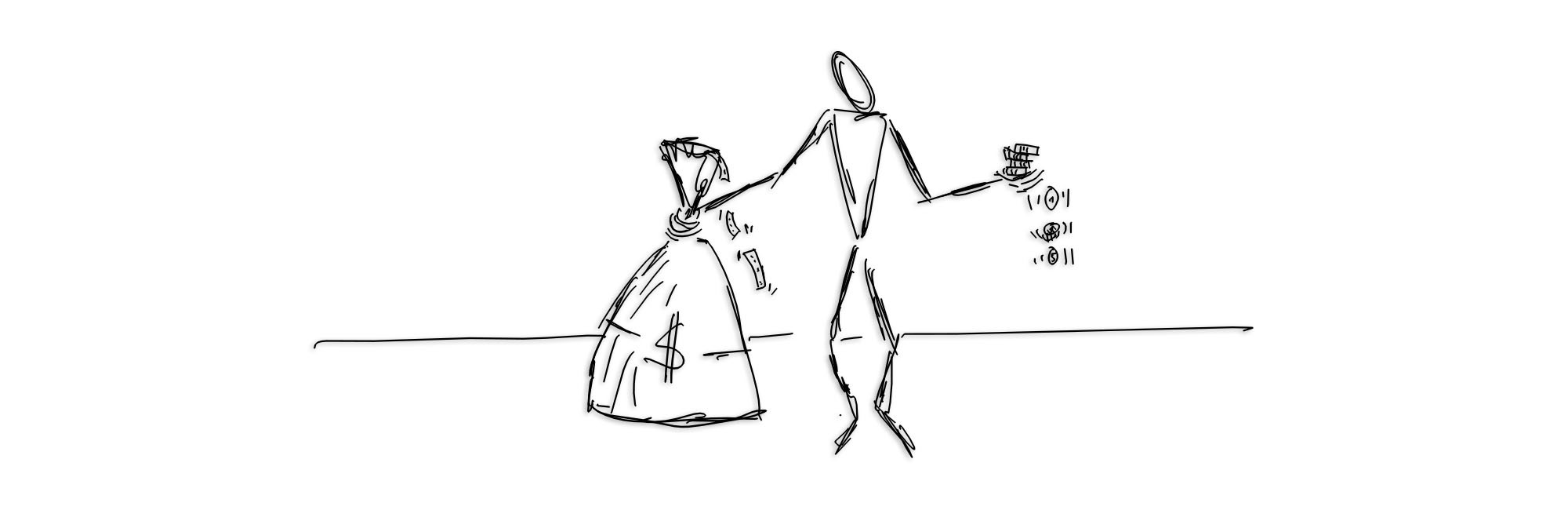Wir sollen Angst haben. Angst vor neuen Steuern, Angst vor Enteignung, Angst davor, dass uns „die da oben“ das letzte Hemd nehmen. Aber Moment mal – wer genau sind eigentlich „die da oben“? Ein Blick in die Statistiken zeigt: Die Zahl der Milliardäre in Deutschland ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Trotz Krisen, Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit. Komisch, oder?
Die Umverteilung von unten nach oben
Es wird immer so getan, als würde jede neue Steuer auf „die kleinen Leute“ abgewälzt. Das ist das Framing. Doch was, wenn wir uns die Definition von Vermögen mal genauer anschauen? Wo fängt es an, wo hört es auf? Während der Mittelstand immer weiter ausblutet, profitieren die Großeinkommen von geschickten steuerlichen Schlupflöchern und Lobbyarbeit. Steuern werden systematisch so gestaltet, dass sie diejenigen am meisten belasten, die ohnehin kaum etwas haben.
Umverteilung passiert dabei in zwei Richtungen: sichtbar und unsichtbar. Sichtbar sind direkte Steuererleichterungen für Unternehmen, Subventionen für Großinvestoren oder die Weigerung, Vermögen adäquat zu besteuern. Unsichtbar hingegen ist der ständige Abbau von sozialer Infrastruktur, steigende Kosten für Wohnen, Gesundheit und Bildung, die zunehmend privat finanziert werden müssen. Wer es sich leisten kann, zahlt – wer nicht, bleibt auf der Strecke.
Diese subtile Form der Umverteilung führt dazu, dass der Mittelstand Schritt für Schritt ausgehöhlt wird, während die Vermögenden ihren Reichtum weiter vermehren. Gewinne werden privatisiert, Risiken sozialisiert. Und während die breite Masse sich mit steigenden Lebenshaltungskosten und stagnierenden Löhnen herumschlägt, steigen Dividenden und Boni ins Unermessliche.
Steuerlast: Wer zahlt wirklich?
Wenn von Steuererhöhungen die Rede ist, geht das Drama los: „Das ruiniert die Wirtschaft!“ „Investoren flüchten!“ „Arbeitsplätze gehen verloren!“ Und während sich alle um die armen Superreichen sorgen, bleibt eine Frage offen: Warum muss die Mittelschicht immer die größte Last tragen? Warum gibt es keine ernsthaften Konzepte zur Besteuerung von Großeinkommen, Erbschaften und Finanztransaktionen?
Die reale Steuerlast ist ungleich verteilt. Die breite Masse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlt ihr Einkommen in vollem Umfang – ohne Steuertricks, ohne Offshore-Konten, ohne kreative „Optimierung“. Konzerne hingegen verschieben Gewinne ins Ausland, reiche Erben vermeiden durch Stiftungsmodelle und Ausnahmeregelungen die Erbschaftssteuer, und große Vermögen bleiben weitgehend unberührt. Das Steuersystem ist so gestaltet, dass es den Status quo sichert: Wer wenig hat, zahlt viel; wer viel hat, zahlt relativ wenig. Das führt dazu, dass die Lohnsteuer den Großteil der Steuereinnahmen ausmacht, während Vermögens- und Kapitalerträge kaum zur Finanzierung des Gemeinwohls beitragen.
Ein Beispiel: Ein normaler Angestellter zahlt auf sein Einkommen 30 bis 40 Prozent Steuern. Ein Konzernchef, dessen Einkommen zum Großteil aus Dividenden und Aktiengewinnen besteht, zahlt darauf oft nur 25 Prozent oder weniger. Und wenn es um Erbschaften oder Unternehmensvermögen geht, schrumpft die Steuerlast dank Sonderregeln noch weiter. Ist das gerecht? Wohl kaum.
Die Angstmaschine
Framing funktioniert so gut, weil es mit Emotionen spielt. Angst ist die größte Waffe, um Menschen in die Defensive zu drängen. Wer Angst hat, stellt keine Fragen. Wer Angst hat, klammert sich an das, was er kennt, auch wenn es ihm schadet. Doch anstatt sich gegeneinander ausspielen zu lassen, sollten wir uns fragen: Wem nutzt dieses Framing eigentlich? Mit Angst können Wahlversprechen gebrochen werden, weil die Schuld umgelagert wird. Plötzlich heißt es, die versprochenen sozialen Entlastungen seien nicht finanzierbar – wegen „der Krise“, wegen „der internationalen Märkte“, wegen „unvorhersehbarer Entwicklungen“. Gleichzeitig bleiben Steuerschlupflöcher für Konzerne und Vermögende unangetastet. Die Angstmaschine sorgt dafür, dass die wahren Profiteure dieser Politik unsichtbar bleiben, während die Kosten erneut bei denen landen, die sowieso schon belastet sind.
Zeit für eine ehrliche Debatte
Wer jetzt ruft, dass eine fairere Steuerpolitik „sozialistisch“ oder gar „kommunistisch“ sei, sollte sich einmal ernsthaft mit klassischer Marktwirtschaft auseinandersetzen. Adam Smith mag als Vater des Kapitalismus gelten, doch selbst er sah vor, dass Wohlstand nicht nur geschaffen, sondern auch zurück in den Kreislauf geführt werden muss. Viele seiner Ideen wurden im Laufe der Zeit verzerrt, um bestehende Machtstrukturen zu erhalten. Doch eine funktionierende Wirtschaft braucht Kaufkraft, stabile Sozialsysteme und eine Infrastruktur, die allen zugutekommt. Eine gerechtere Steuerverteilung ist kein radikaler Akt – sie ist schlicht gesunder Menschenverstand.
Fazit: Solange wir uns vor den falschen Dingen fürchten, bleibt alles beim Alten. Und das kann sich nur eine Gruppe leisten – die, deren Zahl in Deutschland sprunghaft angestiegen ist.