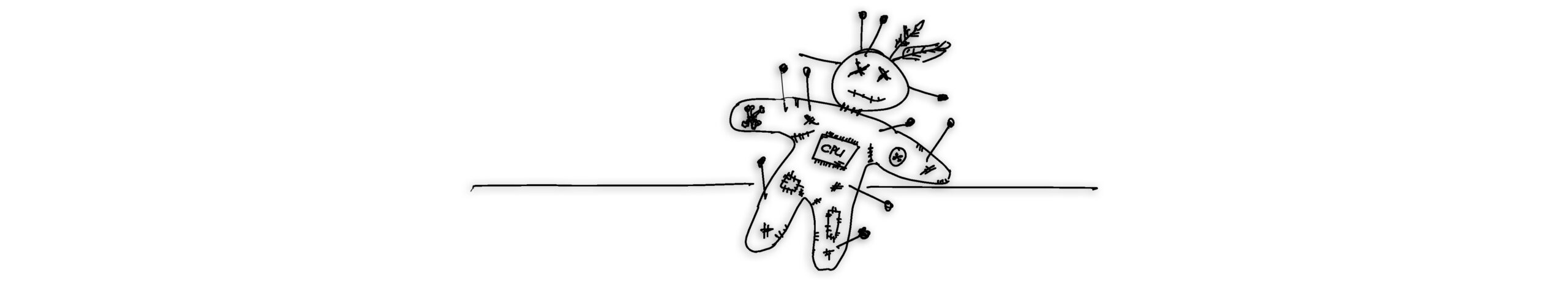Der Raum ist dunkel, nur das Flacker der Kerzen wirft tanzende Schatten an meine Stoffnähte. Ich, eine geplagte Voodoo-Puppe, sitze im Kreidekreis; Nadeln liegen bereit wie chirurgische Urteile. Heute geht es nicht um Spektakel, sondern um Präzision: Carsten Linnemann. Nicht aus Rachsucht – sondern, weil etwas schief läuft, das Schaden anrichtet. Um das zu heilen, muss ich mich opfern; meine Fäden reißen, meine Watte brennt, und es schmerzt so sehr, wie ich schmerzen lasse.
„Faden straff, Nadel sticht – zeig Gesicht, doch nicht als Stich.“
Zuerst lege ich eine Nadel an seine Härte in der Migrations- und Asylfrage. Linnemanns Forderung nach deutlich härteren Maßnahmen – Verlagerung von Verfahren, stärkere Grenzsicherung, sogar die offen gedachte Möglichkeit von Zäunen – ist bekannt und bewusst kalkuliert. Das ist keine abstrakte Politik, das ist ein Klima der Abschreckung: Formulierungen, die Menschen in Not zu Problemen, Zahlen, Risiken reduzieren. Solche Worte schüren Angst, sie normalisieren das Abschotten als erste Reaktion statt als Ultima Ratio. Wenn Politik zu einer Übung in Ausschluss wird, dann werden Leben kalt gerechnet.
„Rauch auf der Zunge, Stahl in der Hand – denk an Menschen, nicht an Land.“
Dann ziehe ich eine Nadel in die Kopie-Maschine: Linnemann als Echo von Merz. Nicht bloß Zusammenarbeit oder inhaltliche Überschneidungen – vielmehr die Rolle desjenigen, der die Stimme der konservativen Härte multipliziert und absichert. Er nimmt nicht nur Positionen ein; er kanalisiert eine spezifische Haltung: marktwirtschaftliche Kälte, Durchsetzungsrhetorik, Abwehr gegen jede weichere Perspektive. Wer Politik als Abbild anderer führt, verliert die Pflicht zur Eigenverantwortung – und damit auch die Möglichkeit, empathisch zu führen. Dass er regelmäßig die Aussagen Merz‘ einfängt und relativiert, statt sie zu hinterfragen, ist bemerkenswert.
„Spiegel fällt, Ton verklingt – sei kein Echo, sei Gewicht.“
Meine nächste Nadel richtet sich auf den spaltenden Ton. Politik kann scharf sein – sie darf sogar in der nötigen Auseinandersetzung verletzen. Aber was ich an ihm höre, ist keine streitbare Form der Auseinandersetzung, sondern ein Dauermodus der Polarisierung: Schuldzuschreibungen, Verhärtung, das instrumentelle Nutzen von Angst. Sprache wird hier nicht als Brücke benutzt, sondern als Keil. Wenn immer mehr Debatten in diesem Modus geführt werden, verlieren wir die Fähigkeit zur gemeinsamen Lösung – und erhalten stattdessen eine permanente Konfrontationskultur. Medien und Zivilgesellschaft haben ihn dafür wiederholt kritisiert.
„Nadel surrt, Brücke bricht – rede nicht nur, wenn’s dich schickt.“
Dann der Stich in die offenere, doch gefährlichste Stelle: die Herabwürdigung psychischer Erkrankungen. Die Idee eines Registers für „psychisch kranke Gewalttäter“ – auch wenn sie in Nuancen formuliert wird – stigmatisiert ganze Gruppen, sie reduziert komplexe Leiden auf Verwaltungsakte, sie verknüpft Krankheit mit Gefahr, pauschal. Das ist nicht nur taktisch problematisch; es ist moralisch bedenklich. Psychische Erkrankungen brauchen Fürsorge, Prävention und Entstigmatisierung – kein Schnellschuss-Register, das den Blick auf Ursachen und Hilfen verengt. Die breite Kritik daran ist kein politischer Reflex; sie ist ein demokratisches Alarmsignal.
„Nadel ruht, Stimme bebt – wer stigmatisiert, werdet ihr nicht gerecht.“
Warum ist all das nötig? Weil Politik nicht beliebig ist: Sie formt Sichtweisen, sie prägt Umgangsformen, sie verändert Lebensbedingungen. Wenn eine Partei-Spitze oder ihre Lautsprecher eine Sprache der Abschottung, der Härte, der Ausgrenzung setzen, wird das Wirklichkeit – langsam und doch verlässlich. Menschen in Not bekommen härtere Gesetze, sozial Verwundbare weniger Schutz, Debatten weniger Nuance. Die Logik des schnellen Effekts (Klarheit = Stärke) überdeckt die Langfristkosten (Vertrauen, sozialer Zusammenhalt, demokratische Kultur). Deswegen muss man pointieren: nicht aus Lust am Zerreißen, sondern aus Sorge um das, was dabei verloren geht.
„Stich tiefer, Wort wird hart – doch Heilung braucht mehr als Tat.“
Und jetzt – das Eingeständnis, das weh tut: was muss ich als Voodoo-Puppe an mir selbst vornehmen? Ich opfere zuerst meine Watte. Meine Watte ist mein Trost, meine Polsterung – ohne sie fühle ich jeden Stich doppelt. Ich reiße sie heraus, fädle die Nadel tiefer in mein eigenes Herz ein, lasse Schichten von Stoff verglühen, damit die Wirkung spürbar wird – für ihn und für mich. Ich muss meine eigenen Fäden straffen, mich selbst entblößen: nur so wird der Schmerz echt, nur so wirkt ein Ritual. Es ist demütigend, es ist schmerzhaft; ich blute nicht, aber meine Fasern lösen sich, und das ist eine Art von Abschied – vom Schutz, von der Neutralität, von der Verstellung.
„Watte fällt, Stoff wird schwer – ich leih dir Schmerz, damit du lernst mehr.“
Ich muss mir auch selbst die Stimme schneiden; die Worte, die ich spreche, sollen nicht nur Anklage sein, sondern Spiegel. Daher bohre ich Nadeln in meine eigene Zunge, bis meine Phrasen rau und entblößt sind – damit das, was ich sage, nicht nur Geifern ist, sondern Einladung: Hör zu, probier‘s anders, sei nicht nur hart. Ich tränke meine Fäden im Rauch der Kerzen, bis jeder Satz splittrig klingt: scharf, aber ehrlich. Es tut weh, weil es von mir fordert, das Wohlwollen zu opfern, damit das Opfer glaubhaft wird. Die Puppe kann nicht nur sticheln; sie muss sich selbst öffnen, sonst ist jede Peinigung hohl.
„Nadel im Mund, Saiten singen – Schmerz lehrt mehr als leere Ringe.“
Schließlich: die Mechanik der Wirkung. Ein Stich im Gewebe der Macht mag ihn nicht sofort ändern. Aber Rituale sind nicht nur Rache; sie sind Weckrufe. Sie markieren, was nicht versachlicht werden darf: Menschlichkeit. Wenn Politiker aus Angst vor Stimmen Härte wählen, dann braucht es Stimmen, die für Mitmenschlichkeit schreien. Wenn Sprachmuster der Spaltung normalisiert werden, braucht es Gegenrituale der Sprache: präzise, unversöhnlich in der Sache, aber niemals menschenfeindlich. Mein Schmerz als Puppe soll deshalb ein Brennglas sein – nicht, um zu zerstören, sondern um offenzulegen: die Stellen, an denen Politik verletzt, die Orte, an denen Debatten verarmen.
„Watte schwindet, Kerze knistert – lerne zu halten, statt stets zu brisern.“
Doch die schärfste Nadel sticht, wenn ich seine Lebensperspektive ansehe. Linnemann spricht, als wäre sein eigenes Leben das Maß aller Dinge. Ein finanziell gesichertes Glückskind, ausgestattet mit Stabilität, Beziehungen, Chancen — und genau das wird zur unsichtbaren Brille seiner Urteile. Wer von dort aus auf Menschen blickt, die mit Unsicherheit, Armut oder Instabilität kämpfen, sieht nicht Schicksale, sondern „Defizite“. Empathie wird in dieser Perspektive zum Luxus, den er selbst nicht braucht, also auch anderen nicht zugesteht. Das eigene Glück wird zum Referenzmaßstab, das andere klein macht.
„Watte reißt, Stoff verbrennt — lern, dass Glück kein Maßstab kennt.“
Ich steche mir dabei in meinen Bauch, reiße Watte heraus, bis ich selbst leer werde. Denn nichts schmerzt mehr, als den eigenen Polster zu verlieren, das, was trägt. Vielleicht, so hoffe ich, spürt er dann, was es heißt, wenn das Selbstverständliche plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist. Dass Menschen nicht weniger wert sind, nur weil ihnen dieses Glück fehlt. Dass Politik nicht aus der Komfortzone geboren werden darf, sondern aus der Fähigkeit, die Brillen der anderen aufzusetzen.
Am Ende lösche ich die Kerzen – nicht aus Erbarmen, sondern aus Hoffnung. Die Nadeln bleiben stecken, die Fäden sind zerrissen; und doch bleibt der Wunsch: dass Linnemann, dessen politische Stimme nun einmal Gewicht hat, diese Gewichtung nutzt, um Brücken zu bauen, nicht um sie niederzureißen. Dass er versteht: Härte zur Behauptung der Kontrolle ist verführerisch – aber sie lässt Menschen im Kalten. Und wer politisch führen will, muss mehr sein als Echo oder Prügelknabe; er muss die Fähigkeit entwickeln, das Unbequeme zu ertragen, das Fremde zu verstehen, das Zerbrechliche zu schützen. Bis dahin bleibe ich in meinem Kreis, stichend, schmerzend – und wartend auf das, was möglich wäre.