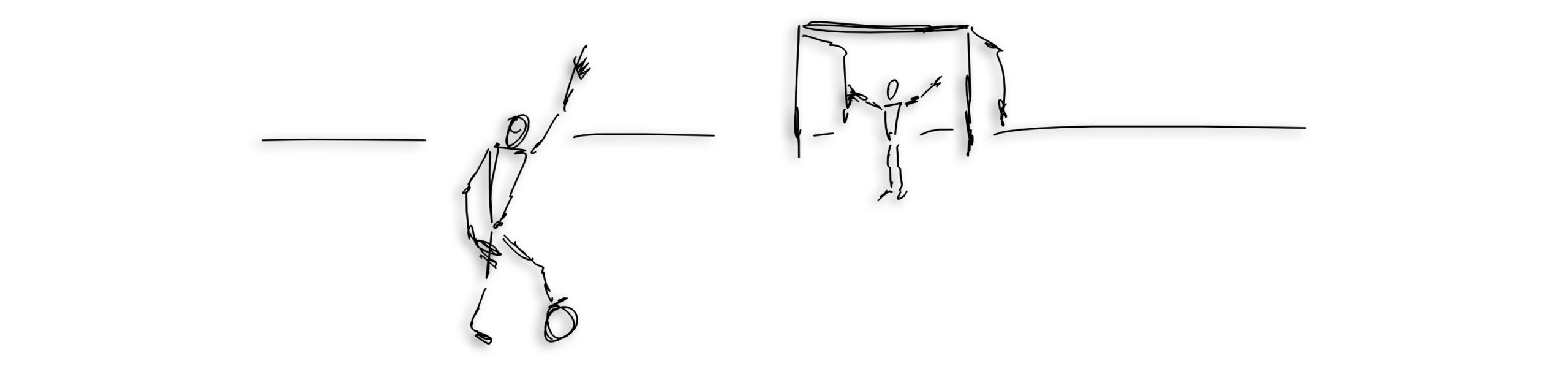Der Fußball kann in Deutschland ohne Zweifel als Massensport Nr. 1 bezeichnet werden. Seine enorme Bedeutung spiegelt sich unter anderem in der speziellen Berücksichtigung im Radiomedienvertrag1 wider, was seine gesellschaftliche Relevanz unterstreicht. Doch nur die wenigsten Fußballer schaffen es in die Topligen und -vereine, wo Millionengehälter gezahlt werden. Das große Gros spielt klassischen Vereinssport oder betreibt Fußball als Freizeitbeschäftigung.
Doch wo Fußball als Spiel beginnt, entwickelt sich nicht selten eine bedenkliche Realität: Aus dem ursprünglich spaßigen Wettkampf entsteht immer öfter Verbissenheit bis hin zu Aggression. Insbesondere gegenüber Schiedsrichtern zeigen sich seit Jahrzehnten aggressive Verhaltensformen, die von verbalen Beschimpfungen („Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht“) bis zu körperlichen Angriffen reichen und auch Minderjährige als Ziel nicht ausnehmen.
Vom Spiel zum Ernstfall
Fußball wird oftmals als Spiel definiert – ein geregeltes sportliches Miteinander mit klaren Regeln, einem Ball, zwei Mannschaften und dem Ziel, mehr Tore als der Gegner zu erzielen. Doch die emotionale Aufladung des Spiels führt dazu, dass sich der „Spielcharakter“ vielfach verliert.
Aggressionen gegen Schiedsrichter oder Mitspieler nehmen zu. Dies zeigt sich insbesondere im Amateur- und Jugendfußball, wo der Schiedsrichter im Gegensatz zu Profis oft allein auf dem Platz steht und sich Entscheidungen in Sekundenbruchteilen abspielen.
Formen und Ursachen der Aggressionen
Die Aggressionen gegenüber Schiedsrichtern äußern sich verbal und körperlich. Eine erschreckende Zahl belegt das Problem: In der Saison 2018/2019 wurden laut Deutschem Fußball-Bund (DFB) knapp 3.000 Angriffe auf Schiedsrichter gemeldet, 685 Fußballspiele mussten deswegen abgebrochen werden. Die Überforderung und Frustation bei Spielern, Trainern oder Zuschauern bei strittigen Entscheidungen führen regelmäßig zu Beleidigungen und physischen Angriffen.
Die Gründe für solche Aggressionen sind komplex und vielschichtig. Zum Einen ist Fußball in Deutschland kulturell tief verankert und hat für viele Spieler und Fans eine hohe emotionale Bedeutung, die sich in Erwartungsdruck und Leistungszwang äußert. Zum Anderen spielt die gesellschaftliche und soziale Dimension eine Rolle: Konflikte aus dem Privatleben oder gesellschaftliche Spannungen werden auf dem Fußballplatz ausgetragen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass bei härteren Spielformen und zunehmendem Leistungsdruck aggressive Verhaltensmuster eher auftreten.
Hinzu kommt, dass Schiedsrichter im Amateurbereich oft wenig Unterstützung erhalten. Besonders empfindlich sind Jungschiedsrichter, die häufig Beleidigungen und Angriffe erleben2. Die Gewalt endet nicht selten nach dem Schlusspfiff, wie Angriffe zum Beispiel nach dem Spiel in der Kabine oder außerhalb des Spielfeldes zeigen.
Erklärungen für Aggressives Verhalten
Aggression im Fußball lässt sich aus verschiedenen Perspektiven erklären: So sind personinterne Faktoren etwa das individuelle Aggressionspotenzial oder das Bedürfnis nach Dominanz wichtige Ursachen. Personexterne Faktoren wie die Spielsituation, das Verhalten von Gegenspielern oder Trainern sowie die Stimmung der Zuschauer wirken ebenso auf die Entstehung von Aggression ein. Fußball lebt auch von hohen Emotionen – die Grenze zwischen legitimer Härte und verbotener Aggression ist oft fließend.
Die lange Tradition verbaler Schiedsrichter-Beleidigungen ist ebenfalls ein sozialpsychologisches Muster, das sich in der Fußballkultur festgesetzt hat. Die sogenannte „Kapitänsregelung“ des DFB, bei der nur die Mannschaftskapitäne mit dem Schiedsrichter diskutieren dürfen, soll dabei helfen, die hitzigen Gefühlsausbrüche zu reduzieren.
Präventions- und Lösungsansätze
Der DFB und zahlreiche Organisationen setzen seit Jahren verschiedene Maßnahmen um, um Gewalt auf dem Platz zu reduzieren und insbesondere Schiedsrichter zu schützen. Hierzu gehören Projekte wie das „DFB-STOPP-Konzept“, das Schiedsrichtern ermöglicht, eine Beruhigungspause anzuordnen, bei der beide Teams in ihre Strafräume zurückziehen müssen, um den Spielfluss kurz zu unterbrechen und Emotionen zu dämpfen.
Weiterhin gibt es Präventionsmodelle, etwa im Jugendfußball, die schon früh das Bewusstsein für Fairplay, Respekt gegenüber Schiedsrichtern und Deeskalation schulen. In Berlin zeigt sich etwa durch den Einsatz von sogenannten „SoccerWorkern“ und Anti-Aggressions-Trainings, dass ein sozialpädagogischer Ansatz wirksam sein kann.
Auch die gesellschaftliche Vorbildfunktion der Profifußballer ist nicht zu unterschätzen – Kritik am Verhalten von Profis und deren Auseinandersetzungen mit Schiedsrichtern kann die Gewaltspirale im Amateurbereich befeuern.
Aufruf an Eltern: Vorbildwirkung und Anerkennung des Spielcharakters
Die Rolle der Eltern im Jugendfußball ist entscheidend – sie sind nicht nur Begleiter, sondern vor allem Vorbilder. Gerade in Zeiten von Verbissenheit und Aggressionen im Fußball ist es wichtig, dass Eltern ein verantwortungsvolles Verhalten an den Tag legen. Ein bewusster Appell an die Eltern sollte daher lauten: Seid Vorbild für Respekt, Fairplay und die Freude am Spiel.
Fußball ist ein Spiel, das durch Zufall und Glücksanteile geprägt ist – nicht jede Entscheidung oder Spielphase kann kontrolliert werden. Dieses Element des Unvorhersehbaren gehört zum Spielcharakter dazu und sollte von Eltern genauso anerkannt und vermittelt werden. Kinder lernen damit, Niederlagen gelassen zu akzeptieren und mit unvorhergesehenen Situationen umzugehen, ohne in Frustration oder Aggression zu verfallen.
Eltern können dazu beitragen, eine positive Atmosphäre zu schaffen, indem sie Spieler, Trainer und Schiedsrichter respektieren, auch bei Fehlentscheidungen ruhig bleiben und ihre Kinder ermutigen, sich an Regeln zu halten. Das bedeutet auch, nicht von außen ins Spiel einzugreifen, ihr Kind unabhängig vom Ergebnis zu loben und den Fokus auf Spaß und Teamgeist zu legen.
Dieser bewusste Umgang fördert nicht nur die gesunde Entwicklung der Kinder, sondern kann auch auf andere Eltern und Zuschauer als positives Vorbild wirken – und so den Fußball als Spiel erhalten, das Freude macht und Gemeinschaft fördert.
Fazit
Fußball ist und bleibt ein Spiel – doch wenn der sportliche Wettkampf zur Plattform für Aggressionen wird, verliert er seine ursprüngliche Bedeutung. Die Ursachen für das aggressive Verhalten gegenüber Schiedsrichtern und im Spiel selbst sind vielschichtig, reichen von sozialem Druck und Emotionen über kulturelle Fußballtraditionen bis zu fehlender Unterstützung und pädagogischer Begleitung. Das nötige Umdenken ist im Gange: Schutzmaßnahmen, klare Regelungen und pädagogische Modelle können helfen, die Gewalt am und um den Fußballplatz zu reduzieren und den Ernst aus dem Spiel zu nehmen.