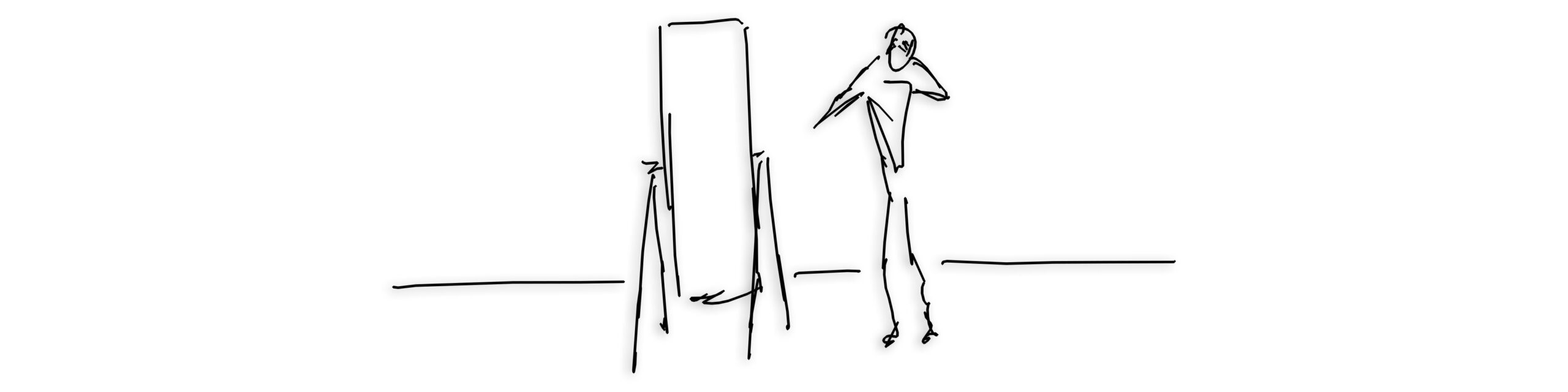Obwohl Politik eigentlich nicht mein Lieblingsthema ist, lassen mich gesellschaftliche Debatten nicht kalt – besonders wenn sie durch weniger offensichtliche Zusammenhänge geprägt sind, die oft außerhalb der politischen Sphäre liegen. Ein aktueller Podcast hat dabei einen besonderen Impuls gegeben, mich mit diesem Thema weiter auseinanderzusetzen.
Friedrich Merz ist ein Phänomen: ein Politiker, der sich als konservativer Modernisierer – ansich schon ein Widerspruch insich – inszeniert, während er mit einem Weltbild operiert, das selbst Helmut Kohl altmodisch gefunden hätte.
Die Frankfurter Schule, allen voran Adorno und Horkheimer, hätten ihre wahre Freude an ihm – oder eher an seiner Dekonstruktion.
Merz ist ein Paradebeispiel für den autoritären Charakter, dessen Handeln weniger aus rationaler Planung, sondern aus unreflektierter Ideologie resultiert. Ein Lehrstück spätbürgerlicher Starrheit, angereichert mit einer guten Prise Beratungsresistenz.
Der autoritäre Machmensch
Merz verkörpert das, was Adorno in seiner „Studie zum autoritären Charakter“ als typischen Repräsentanten einer reaktionären Gesellschaftsstruktur beschrieben hat.
Sein Politikstil ist nicht das Ergebnis einer dialektischen Auseinandersetzung mit den Widersprüchen der Gesellschaft, sondern die autoritäre Affirmation derselben. Er präsentiert sich als harter Macher, der keine Widersprüche duldet – weder in seiner Partei noch in der gesellschaftlichen Debatte.
Ein Kernmerkmal des autoritären Charakters ist die Sehnsucht nach klaren Hierarchien, verbunden mit einer Abneigung gegenüber Ambivalenzen oder kritischer Reflexion.
Beratungsresistenz und Altersstarrsinn
Merz‘ Unfähigkeit, sich inhaltlich weiterzuentwickeln, ist symptomatisch für eine konservative Politik, die nicht auf Transformation, sondern auf Beharrung setzt. Seine berüchtigte Beratungsresistenz – von der CDU-internen Führungskrise bis zu seinen Positionen zu Migration und Sozialstaat – spiegelt das wider, was die Kritische Theorie als „repressives Bewusstsein“ bezeichnen würde: ein Denken, das sich gegen jede Form von Diskursimmanenz sperrt und stattdessen auf Dogmatismus setzt.
Dabei ist es weniger ein gezieltes Kalkül als eine tief sitzende Unfähigkeit zur Selbstreflexion.
Dass er sich mit zunehmendem Alter immer stärker in seinen Überzeugungen einbunkert, könnte man als Altersstarrsinn abtun – oder als das letzte Stadium des autoritären Charakters, der, wie Adorno und Fromm beschrieben haben, mit fortschreitendem Realitätsverlust in die Regression übergeht.
Merz reagiert nicht auf die Gesellschaft, er klammert sich an eine Version davon, die es so längst nicht mehr gibt.
Faschistoide Züge?
Natürlich ist Merz kein Faschist im historischen Sinne. Doch das bedeutet nicht, dass er frei von faschistoiden Denkmustern wäre. Horkheimer formulierte einst den berühmten Satz: „Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen.“
Merz‘ Politik ist eine konsequente Verteidigung der bestehenden Eigentumsverhältnisse, die im Zweifel repressiv gegen jede Form der Systemkritik vorgeht. Sein Populismus, seine Diskursverengung, seine Polarisierung und die bewusste Inszenierung als „starker Mann“ weisen deutliche Anleihen an autoritäre Bewegungen auf.
Seine Angriffe auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, seine Rhetorik gegenüber Migranten und seine Weigerung, sich differenziert mit gesellschaftlichen Widersprüchen auseinanderzusetzen, könnten Adorno als Bestätigung seiner Thesen über die Wiederkehr des Faschismus in der Demokratie erscheinen lassen.
Merz ist kein ideologischer Faschist, aber er bedient Strukturen, die in autoritäre Dynamiken münden können.
Merz: Planer oder Bauchpolitiker?
Merz gibt sich gerne als strategischer Denker, doch seine Politik ist oft von spontanen Reflexen geprägt. In der Tradition der Frankfurter Schule könnte man sagen, dass er nicht aus einem analytischen Verständnis der Gesellschaft heraus agiert, sondern aus einem vorbewussten Ressentiment.
Seine Politik ist weniger wissenschaftlich als affektiv: Sie speist sich aus dem Gefühl, dass die Welt aus den Fugen geraten sei – und dass die Lösung darin bestehe, diese in eine vermeintliche Ordnung zurückzuzwingen.
Die Frankfurter Schule würde Friedrich Merz wohl als letztes Aufbäumen einer überholten gesellschaftlichen Klasse deuten. Er ist das Relikt einer Ordnung, die sich gegen ihre eigene Überwindung sträubt. Ein lebender Widerspruch – und damit ein perfekter Untersuchungsgegenstand für eine kritische Theorie der Gegenwart.