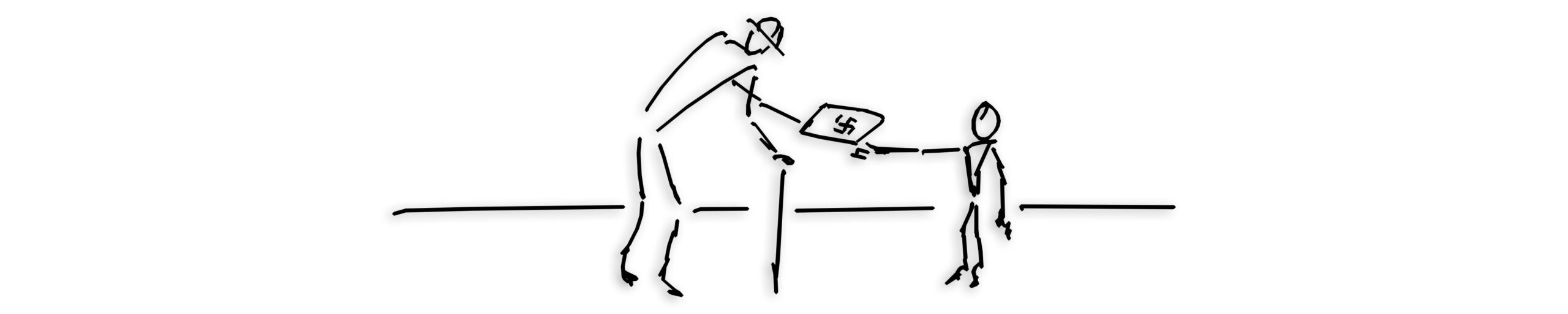Einleitung: Zwischen Schein und Sein – Die doppelte Alterung unserer Gesellschaft
Deutschland altert – das lässt sich weder demografisch noch gesellschaftlich leugnen. Die Alterspyramide hat sich zur Urne gewandelt: Weniger Junge, immer mehr Ältere. Und doch lebt der öffentliche Diskurs von jugendlichen Idealen: Glatte Haut, dynamische Lebensführung, modische Trends. Ein kollektiver Jugendwahn regiert Medien, Werbung, Lifestyle. Gleichzeitig aber zeigt ein Blick in Parlamente, Aufsichtsräte und Entscheidungsetagen: Es sind die Älteren, die die Fäden ziehen. Dieser Widerspruch – Kultur für Junge, Politik für Alte – wirkt zunehmend schizophren. Ist Altern in unserer Gesellschaft überhaupt akzeptiert? Oder verbergen wir es nur hinter kosmetischen Idealen und jugendlicher Selbstinszenierung?
Jugend als Norm: Wenn Altern zur Abweichung wird
Die Norm unserer Zeit ist die Jugend. Sichtbar wird das überall dort, wo es um Körper, Kleidung, Auftreten geht: Fashiontrends orientieren sich am Streetstyle Zwanzigjähriger, selbst Mode für 60-Jährige sieht heute oft so aus, als wäre sie direkt aus einem College-Katalog entnommen. Werbung propagiert „Ageless Beauty“ – eine Schönheit ohne Altersgrenze, die letztlich nur eines meint: alt sein, aber bitte nicht so aussehen. Diese Entwicklung hat Folgen. Wer älter wird, verliert nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch gesellschaftliches Ansehen. Altersdiskriminierung wird selten laut ausgesprochen, ist aber tief in Alltag, Sprache und Arbeitswelt eingebrannt. Altern wird nicht als Entwicklung, sondern als Mangel verstanden – an Attraktivität, Anpassungsfähigkeit, Produktivität.
Politik der Alten, inszenierte Jugendlichkeit – eine gespaltene Gesellschaft
Gleichzeitig erleben wir auf politischer Ebene das Gegenteil. Die Generation der Babyboomer sitzt an den Hebeln der Macht: In Ministerien, Unternehmensleitungen, Verbänden. Das wäre an sich nicht problematisch – gäbe es nicht einen auffälligen Generationen-Gap in politischen Entscheidungen. Themen wie Bildung, Digitalisierung oder Klimawandel werden oft mit Blick auf den Status quo verhandelt – nicht auf die Zukunft. Es entsteht eine paradoxe Situation: Gesellschaftlich wird Jugend glorifiziert, politisch aber regiert das Alter. Die Folgen sind Spannungen, die sich in Wahlergebnissen, Protestbewegungen und einem Vertrauensverlust gegenüber Institutionen zeigen.
Alter und Arbeit: Erfahrung als Ballast?
Ein besonders sensibles Feld dieses Spannungsverhältnisses ist der Arbeitsmarkt. In Zeiten des Fachkräftemangels wäre es logisch, auf erfahrene Mitarbeiter zu setzen – auf Wissen, Routine, Souveränität im Umgang mit komplexen Situationen. Doch die Realität sieht oft anders aus. Mit zunehmendem Alter steigen die Hürden: Fortbildungen richten sich primär an Jüngere, digitale Transformation wird vor allem mit jungen Teams verknüpft. Ältere gelten schnell als „nicht mehr formbar“, ihre Erfahrung wird ignoriert oder gar als Hemmnis betrachtet. Dabei sind es gerade sie, die in Krisen stabilisieren, Prozesse überblicken und oft das Rückgrat ganzer Abteilungen bilden. Die Abwertung erfahrener Arbeitskraft ist nicht nur ökonomisch kurzsichtig – sie zeugt auch von einer kulturellen Blindheit gegenüber dem Wert des Alters. Wer Kompetenz allein an Jugend koppelt, verliert nicht nur Produktivität, sondern auch Menschlichkeit.
Altern als Identitätskrise: Warum das Selbstbild wankt
Das gesellschaftliche Bild vom Altern prägt auch das individuelle Selbstbild. Wer sich dem Jugendideal nicht mehr zugehörig fühlt, gerät schnell in eine Identitätskrise. Die permanente Aufforderung, „jung zu bleiben“, lässt wenig Raum für ein würdevolles, selbstbestimmtes Altern. Viele Menschen erleben den Übergang ins Alter als Verlust: von Relevanz, Attraktivität, Anschluss. Das liegt nicht nur am eigenen Erleben, sondern vor allem an fehlenden positiven Altersbildern. Es mangelt an Vorbildern, die zeigen, dass Alter nicht Stillstand, sondern Umbruch, Freiheit und neue Tiefe bedeuten kann.
Neue Altersbilder – ein gesellschaftliches Projekt
Um aus dem Dilemma zwischen Jugendwahn und Altersmacht herauszufinden, braucht es eine kulturelle Neuausrichtung. Altern muss enttabuisiert, sichtbar und vielstimmig erzählt werden. Das heißt: Mehr ältere Menschen in Medien – nicht als Karikatur, sondern als reflektierte Persönlichkeiten. Mehr Durchlässigkeit im Arbeitsmarkt – nicht als Gnadenbrot, sondern als echte Perspektive. Und eine Politik, die demografische Realität mit kultureller Vision verbindet. Das Ziel ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch: Jugend und Alter als gleichwertige, sich ergänzende Pole des Lebens. Nicht Konkurrenz, sondern Dialog.
Fazit: Jugendwahn überleben – mit Erfahrung, Würde und Mut zum Alter
Die Gesellschaft steckt in einem Selbstwiderspruch: Sie altert rasant, tut aber alles, um das Altern zu kaschieren. Sie glorifiziert die Jugend, überlässt aber den Alten die Macht. Sie fordert Veränderung, blendet aber die Ressource Erfahrung aus. Um zukunftsfähig zu bleiben, müssen wir diesen Widerspruch auflösen. Indem wir Altern nicht als Makel, sondern als Teil unserer Identität begreifen. Indem wir erfahrene Menschen nicht übersehen, sondern einbinden. Und indem wir lernen, dass Würde nicht im jugendlichen Schein liegt – sondern in der Klarheit des gereiften Blicks.