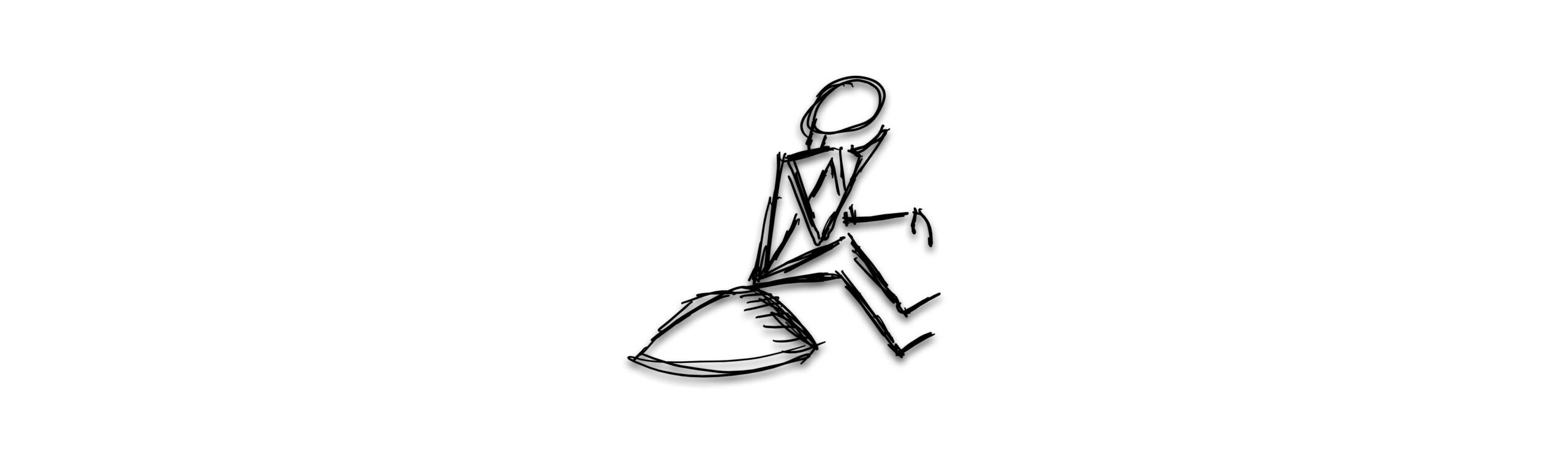Selber denken ist ja so eine Sache. Früher galt das mal als Tugend. Heute ist es eher ein radikaler Akt, irgendwo zwischen staatsfeindlich und verschwörungstheoretisch angesiedelt. Besonders dann, wenn man sich erlaubt, das Offensichtliche zu hinterfragen. Zum Beispiel: Warum verbieten zehn US-Bundesstaaten plötzlich mRNA-Impfungen? Darwin scheint da endlich mal wieder Oberwasser zu bekommen.
Vom mündigen Bürger zum staatlich geprüften Mitläufer
Natürlich könnte ich einfach mitmachen. Kopf ausschalten, Maske auf, Spritze rein, Schnauze halten. So läuft das Spiel schließlich. Aber irgendwas in mir – vermutlich mein Restverstand – weigert sich hartnäckig, sich dieser Maschinerie aus Pseudo-Logik und kafkaesken Vorschriften zu unterwerfen.
Ich meine, wer hätte gedacht, dass wir 2025 ernsthaft darüber diskutieren, ob eine medizinische Technologie per Gesetz verboten werden soll, während im gleichen Land Sturmgewehre problemlos im Walmart erhältlich sind?
Wie stark muss ich mich eigentlich verbiegen?
Da stehe ich nun, ich armer Tor, und frage mich: Wie viel Selbstverleugnung ist noch gesund? Reicht es, die eigene Meinung nur in der Dusche laut zu sagen? Oder sollte ich besser auch da schon flüstern, falls Alexa mithört? Die staatlichen Regelungen werden jedenfalls nicht klüger, nur weil ich sie brav befolge.
Wenn der Staat morgen beschließt, dass Schwerkraft optional ist – muss ich dann schweben, um kein Bußgeld zu riskieren?
Ungehorsam aus Prinzip: Mut oder Größenwahn?
Ich gestehe: Ich lese Studien. Ich konsultiere Experten. Ich bilde mir eine eigene Meinung. Damit bin ich natürlich gefährlich. Nicht für mich – aber für das System, das auf Konformität und Gehorsam getrimmt ist. Dabei ist mein Ungehorsam kein Selbstzweck. Ich will nicht rebellieren, um zu rebellieren. Ich will nur nicht blöd mitmachen, wenn’s keinen Sinn ergibt.
Mein Wissen ist keine Allwissenheit. Aber es ist mein Wissen. Und wenn ich mich schon irre, dann wenigstens aus freien Stücken.
Ethik: Der Elefant im Raum
Was ist richtig? Was ist falsch? Früher konnte man sich auf ein moralisches Koordinatensystem verlassen. Heute fühlt sich alles relativ an – es sei denn, man widerspricht der Mehrheitsmeinung. Dann ist man plötzlich „unsolidarisch“, „unsensibel“ oder gleich „gefährlich“.
Aber meine Ethik basiert nicht auf Regierungsverordnungen. Ich messe das Gute nicht am Gesetzestext, sondern an Wirkung und Verantwortung. Und ja, manchmal ist es eben ethisch geboten, nicht zu gehorchen.
Die Grenze des Denkens: Mein persönlicher Horizont
Natürlich gibt es Grenzen. Nicht jeder Gedanke führt ins Licht. Manche enden im Aluhut. Aber die Grenze ist nicht da, wo es unbequem wird. Sie liegt da, wo der Gedanke aufhört, auf Realität und Logik zu fußen. Ich prüfe, bevor ich glaube. Und manchmal glaube ich dann halt nicht das, was ich glauben soll.
Ich will keine absolute Freiheit. Ich will nur die Freiheit, nachzudenken. Und mich dann für das <emmir Richtige zu entscheiden – auch wenn das nicht im Gesetzblatt steht.
Fazit: Mein Weg – jenseits des Mainstreams
Ich habe keine Lust mehr auf die ewige Selbstverleugnung. Auf das Sich-Verbiegen im Namen einer Logik, die sich ständig selbst widerspricht. Ich werde weiter lesen, fragen, zweifeln – und manchmal widersprechen. Nicht aus Rebellion, sondern aus Vernunft.
Und wenn mich das zur persona non grata macht – dann soll es so sein. Denn wer selber denkt, der lebt gefährlich. Aber wenigstens lebt er wirklich.