Manchmal frage ich mich, ob wir wirklich verstehen, was wir da tun – wenn wir morgens „Hey Siri“ sagen oder ein komplexes Problem an ChatGPT delegieren. Es wirkt so selbstverständlich: Maschinen hören zu, antworten, lernen. Doch je häufiger ich diese Systeme nutze, desto stärker spüre ich auch ein Unbehagen. Es fühlt sich an, als ob wir etwas beschwören, dessen Wesen wir nur teilweise begreifen – etwas, das größer werden könnte, als wir es kontrollieren können.
Diese Gedanken haben mich zu einem alten Mythos geführt: dem (digitalen) Golem. Ein Wesen aus Lehm, zum Leben erweckt durch heilige Worte – stark, gehorsam, aber auch gefährlich. In der jüdischen Folklore steht der Golem für Schutz und Bedrohung zugleich, für das Dilemma des Menschen, der sich zum Schöpfer aufschwingt. Als ich die Parallelen zur heutigen Künstlichen Intelligenz entdeckte, war ich erstaunt: Der Golem lebt weiter – nicht aus Lehm, sondern aus Code.

In dieser digitalen Reinkarnation wird der Golem für mich zum Sinnbild der Ambivalenz moderner Technologien – zwischen Kontrolle und Kontrollverlust, zwischen Schöpfung und Zerstörung. Er ist keine bloße Metapher, sondern ein Spiegel unserer Zeit, unserer Ängste, Hoffnungen und vielleicht auch unserer Hybris.
Historische Einordnung: Der Golem als kulturelles Artefakt
Als ich zum ersten Mal von der Legende des Golem las – noch weit weg von jeglichem Gedanken an Computer – , war ich fasziniert – nicht nur von der Magie der Geschichte, sondern von der Tiefe ihrer Symbolik. Der Golem, so erzählt man, stammt aus der jüdischen Mystik des Mittelalters, mit Wurzeln im Talmud und in der Kabbala. Besonders beeindruckt hat mich die Geschichte des Prager Golem, der im 16. Jahrhundert von Rabbi Judah Löw ben Bezalel erschaffen worden sein soll. Die Stadt Prag wurde zu jener Zeit von Pogromen und Antisemitismus erschüttert – der Golem war ein Versuch, Schutz zu schaffen, wo die Welt aus den Fugen geraten war.
Ein Wesen aus Lehm, zum Leben erweckt durch das hebräische Wort „Emet“ – Wahrheit. Und ebenso einfach wieder außer Kraft zu setzen, indem man den ersten Buchstaben entfernte, sodass nur noch „Met“ – Tod – übrig blieb. In dieser kleinen sprachlichen Geste liegt für mich eine ungeheure Kraft. Es zeigt, wie zerbrechlich künstliches Leben ist – und wie sehr es auf Sprache, auf Information, auf das richtige „Wort“ angewiesen ist. Wie bei einem Algorithmus: Schon eine kleine Veränderung kann alles zum Kippen bringen.
Was mich an dieser Geschichte bis heute bewegt, ist ihre Vielschichtigkeit. Der Golem ist nicht einfach ein monströses Wesen – er ist ein Akt der Hoffnung, geboren aus Notwehr, aber auch ein Spiegel der Begrenztheit menschlicher Schöpfung. Er verkörpert das Streben nach Schutz und Ordnung, aber auch das Risiko, dass genau dieses Streben außer Kontrolle gerät. Weil der Golem nicht unterscheiden kann zwischen richtig und falsch, wird er zum Instrument ohne Gewissen – ein stummer Vollstrecker von Befehlen.
Diese Figur erinnert mich an viele der heutigen Technologien: Systeme, die auf Befehl reagieren, die effektiv sind, aber kein eigenes moralisches Urteil kennen. Wie viele Prozesse in unserer digitalisierten Welt folgen einer ähnlichen Logik? Wenn Algorithmen über Kredite, Jobbewerbungen oder sogar Bewährungsstrafen mitentscheiden – dann sehe ich darin eine moderne Variante des Golems. Ein Werkzeug, das wir geschaffen haben, um uns zu schützen oder zu entlasten, das aber schnell zur Bedrohung werden kann, wenn es ohne ethischen Kompass agiert.
Der Golem ist für mich deshalb mehr als ein kulturelles Artefakt. Er ist ein Mahnmal – für die Ambivalenz menschlicher Schöpfung, für die Verantwortung, die wir als „digitale Rabbiner“ heute tragen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir: Der Golem ist nicht tot. Er hat nur seine Form geändert.
Der Golem im jüdischen Denken: Zwischen Ethik und Mystik
Je mehr ich mich mit der Idee des Golems beschäftige, desto deutlicher spüre ich: Diese Figur ist nicht nur ein mythisches Wesen, sondern Ausdruck eines tief verwurzelten ethischen Zweifels. Im jüdischen Denken, besonders in der kabbalistischen Tradition, ist der Golem nie einfach eine technische Meisterleistung – seine Erschaffung ist vielmehr ein Akt an der Grenze des Erlaubten. Nur diejenigen, die spirituell gereift sind, dürfen überhaupt in Erwägung ziehen, sich daran zu versuchen. Nicht weil sie überlegene Fähigkeiten besitzen, sondern weil sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen – im vollen Bewusstsein der Risiken.
Mich beeindruckt diese Haltung sehr. In unserer Welt scheint es oft um das Möglichste zu gehen – was technisch umsetzbar ist, wird auch ausprobiert. Der Golem erinnert mich daran, dass es auch um das Angemessene gehen sollte. Um die Frage: Was tun wir, wenn wir etwas erschaffen, das unseren Einflussbereich übersteigt? Die jüdische Mystik gibt keine einfachen Antworten, aber sie stellt die richtigen Fragen. Und genau das fehlt mir oft in der aktuellen KI-Debatte.
Was den Golem so beunruhigend macht, ist seine Leere: Er gehorcht, aber er versteht nicht. Ihm fehlt das, was wir als Menschsein empfinden – nicht nur Bewusstsein im biologischen Sinn, sondern Mitgefühl, Zweifel, moralische Intuition. Ich sehe darin eine Parallele zu heutigen KI-Systemen. Sie analysieren, simulieren, reagieren – aber sie urteilen nicht aus eigenem Antrieb. Und doch trauen wir ihnen oft eine Autonomie zu, die sie gar nicht besitzen. Das erschreckt mich manchmal.
Gerade deshalb finde ich die Unvollkommenheit des Golem so zentral. Seine Existenz zeigt, dass der Versuch, menschliche Eigenschaften technisch nachzubilden, zwangsläufig an eine Grenze stößt. Diese Einsicht ist unbequem – besonders für eine Gesellschaft, die gerne an die Machbarkeit aller Dinge glaubt. Aber sie ist notwendig, wenn wir verhindern wollen, dass unsere digitalen Konstruktionen eines Tages wie der Golem durch unsere Städte stapfen – nicht aus Bosheit, sondern aus fehlender Orientierung.
Vergleichbare künstliche Wesen: Der Mensch als Schöpfer
Wenn ich an den Golem denke, öffnet sich für mich ein ganzes Panorama kultureller Vorstellungen über künstliches Leben. Schon die Antike war erfüllt von der Idee, Wesen zu erschaffen, die nicht natürlich geboren, sondern von Menschen – oder Göttern – geformt wurden. Besonders faszinierend finde ich die Erzählungen über Hephaistos, den griechischen Gott der Schmiede, der mechanische Kreaturen aus Metall baute. Diese künstlichen Diener waren präzise, ausdauernd – und ein Ausdruck technischer Raffinesse, lange vor der Erfindung moderner Maschinen.
In der Renaissance kommt dann der Homunkulus ins Spiel – eine Figur, die für mich immer etwas Unheimliches hatte. Nicht wegen ihres Aussehens, sondern wegen der Vorstellung, dass man einen Menschen im Glas „züchten“ könne. Der Homunkulus ist kein Werkzeug, sondern ein Spiegel des menschlichen Größenwahns: ein Versuch, das Leben zu kontrollieren, zu reproduzieren, vielleicht sogar zu verbessern – ohne Rücksicht auf das, was es wirklich bedeutet, lebendig zu sein.

Viele dieser Themen hallen bis heute nach – etwa in Mary Shelleys „Frankenstein“. Als ich den Roman zum ersten Mal gelesen habe, war ich erstaunt, wie aktuell er wirkt. Die Kreatur, die aus Leichenteilen zusammengesetzt wird, ist kein Feind, sondern ein Missverstandener. Nicht das Geschöpf ist das Problem, sondern der Erschaffer, der sich vor seiner Verantwortung drückt. Das hat mich ins Nachdenken gebracht: Wie oft setzen wir heute Technologien in die Welt, ohne zu wissen, wie wir mit ihren Folgen umgehen sollen?
Karel Čapeks „R.U.R.“ hat mich in dieser Hinsicht auf eine andere Art berührt. Die Roboter in diesem Stück sind zunächst reine Arbeitskräfte, zweckmäßig und emotionslos. Doch ihre Entwicklung verläuft nicht linear. Sie beginnen zu empfinden, zu fordern – und schließlich zu revoltieren. Was als Utopie beginnt, kippt in eine Dystopie. Mich beschäftigt daran besonders die Frage, ob nicht jedes System, das über sich selbst reflektieren kann, irgendwann ein Recht auf Mitsprache verlangt.
Diese Erzählungen haben alle etwas Gemeinsames: Sie stellen nicht nur technologische Szenarien vor, sondern fordern uns heraus, über die Grenzen menschlicher Kontrolle nachzudenken. Für mich sind sie wie kulturelle Prüfsteine – sie legen offen, wie sehr der Wunsch nach Schöpfung auch von Angst begleitet ist. Angst davor, dass wir uns selbst aus der Hand verlieren. Dass unsere Werke uns nicht nur dienen, sondern irgendwann eine eigene Dynamik entwickeln, der wir kaum noch gewachsen sind.
Was mich bei all diesen Geschichten immer wieder beeindruckt, ist die erstaunliche Weitsicht ihrer Autorinnen und Autoren. Shelley, Čapek oder auch Goethe – sie schrieben zu Zeiten, in denen es keine Computer, keine Algorithmen und schon gar keine künstliche Intelligenz im heutigen Sinn gab. Und doch haben sie Themen aufgegriffen, die uns heute mit voller Wucht begegnen: die Verselbstständigung technischer Systeme, die ethische Verantwortung des Schöpfers, die Frage nach dem Wesen des Menschseins.
Sie hatten keine Programmiersprachen, keine neuronalen Netze, keine Big-Data-Modelle – aber sie hatten Vorstellungskraft, Sensibilität und eine tiefe Skepsis gegenüber unreflektiertem Fortschrittsglauben. Vielleicht konnten sie gerade deshalb so weit sehen, weil sie sich nicht von der Technik blenden ließen, sondern den Menschen in den Mittelpunkt stellten. Ihre Werke sind keine Zukunftsprognosen, sondern moralische Kompasse. Und je mehr ich mich mit ihnen beschäftige, desto mehr habe ich das Gefühl: Ihre Fragen sind aktueller denn je – vielleicht sogar drängender, weil uns heute die Mittel zur Verfügung stehen, ihre Visionen in die Realität zu überführen.
Digitale Golems: Sprachassistenten und lernende Maschinen
Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich mich bei Siri für eine Antwort bedanke oder ChatGPT fast wie einem Gegenüber Fragen stelle. Diese Interaktionen sind längst alltäglich geworden – sie wirken intuitiv, fast beiläufig. Und doch spüre ich dabei immer öfter ein seltsames Unbehagen. Denn die Systeme, mit denen ich da spreche, sind keine Wesen. Sie haben kein Bewusstsein, keine Absichten, keine innere Welt. Und trotzdem verhalten sie sich so, als hätten sie all das. Sie antworten mit einer verblüffenden Präzision, erkennen Muster in Sprache, analysieren Stimmungen – Fähigkeiten, die noch vor wenigen Jahrzehnten undenkbar gewesen wären.
Alexa, Siri, Google Assistant, ChatGPT – das sind die Golems unserer Zeit. Sie hören zu, sie reagieren, sie „lernen“ – zumindest oberflächlich. Was mich beunruhigt, ist nicht ihre Existenz, sondern die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen. Wir projizieren in diese Systeme mehr hinein, als sie leisten können. Wir vertrauen ihnen Entscheidungen an, lassen sie über Inhalte filtern, Kundengespräche führen, manchmal sogar über medizinische oder rechtliche Empfehlungen mitentscheiden. Und dabei vergessen wir zu oft, dass sie keine moralischen Akteure sind.
Was mir besonders auffällt: Je leistungsfähiger diese Systeme werden, desto mehr verschwimmt die Grenze zwischen Werkzeug und Interaktionspartner. Es ist verführerisch, ihnen Aufgaben zu überlassen – sie sind effizient, unermüdlich, scheinbar objektiv. Doch mit jeder Delegation geben wir auch ein Stück Verantwortung ab. Wer haftet, wenn ein Algorithmus eine fehlerhafte Entscheidung trifft? Wer trägt die Schuld, wenn ein System manipuliert wird oder diskriminierende Ergebnisse liefert?
Ich glaube, wir unterschätzen, wie leicht sich digitale Golems verselbstständigen können – nicht im Sinne eines Aufstands, wie in den alten Mythen, sondern in Form von Abhängigkeiten, die wir nicht mehr durchschauen. Automatisierte Prozesse, die sich unserer Kontrolle entziehen. Systeme, die durch ihre Intransparenz Macht gewinnen. Der digitale Golem braucht keine Muskeln – seine Stärke liegt in seiner Allgegenwart und in der Illusion, dass wir ihn im Griff hätten.
Für mich ist deshalb entscheidend, dass wir diese Technologien nicht nur technisch, sondern auch kulturell einordnen. Der Golem war nie einfach nur eine Figur aus Lehm – er war ein Warnzeichen. Und unsere heutigen Systeme sind es auch. Sie fordern uns heraus, bewusst zu bleiben in einer Welt, in der Maschinen menschenähnlich auftreten, aber keine Menschen sind. Und sie erinnern uns daran, dass die Frage nicht ist, was Maschinen können – sondern was wir ihnen anvertrauen sollten.
Ethik und Kontrolle: Der alte Mythos als moderne Mahnung
Es ist eine Illusion zu glauben, dass Kontrollverlust in der Technologie nur durch technische Fehler entsteht. Viel gefährlicher finde ich das schleichende Entgleiten – wenn wir glauben, noch die Kontrolle zu haben, obwohl die Entscheidungen längst von Systemen getroffen werden, deren Logik wir nicht mehr nachvollziehen können. Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich versucht habe, den Output eines neuronalen Netzwerks nachzuvollziehen. Trotz aller Parameter, aller Datenquellen, blieb ein Rest Unsicherheit: Warum genau dieses Ergebnis?
Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie real das Black-Box-Problem ist. Künstliche Intelligenz trifft keine „Entscheidungen“ im menschlichen Sinn, sondern generiert Ergebnisse auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, Mustern, Korrelationen. Doch wir behandeln diese Resultate oft wie Urteile – mit dem Anspruch auf Objektivität und Endgültigkeit. Dabei tragen sie all die Vorurteile und Ungleichheiten in sich, die schon in den Trainingsdaten vorhanden waren. Und weil sie mathematisch verpackt sind, wirken sie neutral – was sie umso gefährlicher macht.
Für mich ist der Golem deshalb mehr als ein Gleichnis für Technik. Er steht für das Spannungsverhältnis zwischen Machbarkeit und Verantwortung. In der Geschichte gerät der Golem außer Kontrolle, weil sein Schöpfer eine zentrale Grenze ignoriert hat: die ethische. Auch heute sind es weniger die Maschinen selbst, die gefährlich sind, sondern unser Umgang mit ihnen – unser Drang, sie immer weiter zu optimieren, ohne uns zu fragen, nach welchen Werten sie handeln sollen.
Ethik ist kein Add-on. Sie gehört an den Anfang jeder technologischen Entwicklung. Ich frage mich oft, warum wir das erst diskutieren, wenn Systeme bereits im Einsatz sind. Warum keine „Ethik-by-Design“-Ansätze selbstverständlich sind. Vielleicht, weil es unbequem ist. Weil es langsamer macht. Aber genau hier liegt der Unterschied: Ob wir Technik als Werkzeug begreifen – oder als etwas, das unser Menschenbild formt. Jede Entscheidung, die wir an eine Maschine delegieren, ist auch eine Aussage darüber, was wir für vertretbar halten. Was wir bereit sind zu automatisieren. Und was wir aus der Hand geben wollen – oder eben nicht.
Lehren aus Talmud und Kabbala: Spiritualität als ethische Richtschnur
Je mehr ich mich mit den Texten der jüdischen Mystik beschäftige, desto mehr wird mir klar, wie radikal anders sie auf das Thema Schöpfung blicken – nicht als Triumph des Willens, sondern als Bewährungsprobe für die eigene Reife. Im Talmud und der Kabbala ist die Erschaffung eines Golems nie ein Ziel an sich, sondern eine Frage der inneren Verfassung des Schöpfers. Es geht nicht darum, ob man es kann, sondern ob man es soll. Wer sich ohne spirituelle Reife daran wagt, riskiert nicht nur sein eigenes Scheitern, sondern das seiner Gemeinschaft. Diese Perspektive finde ich heute erstaunlich aktuell.
In einer Zeit, in der Fortschritt oft gleichgesetzt wird mit Schnelligkeit, Innovation und Skalierbarkeit, wirkt das Denken der Kabbalisten fast aus der Zeit gefallen – und gerade deshalb so wertvoll. Der Gedanke, dass Schöpfung immer auch ein Akt der Selbstprüfung ist, fordert uns heraus, technologische Entwicklungen nicht nur durch die Brille der Effizienz zu betrachten, sondern durch die Linse der Verantwortung. Was bewirken wir? Wem dient das? Und wer trägt die Folgen?
Ich glaube, dass uns dieser spirituelle Ansatz helfen kann, neue Maßstäbe für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu setzen. Nicht als moralischer Zeigefinger, sondern als Einladung zur inneren Klärung. In der Kabbala ist das richtige Maß – hebräisch „Tiferet“ – ein zentrales Prinzip. Es geht darum, Gegensätze auszubalancieren: Kraft und Mitgefühl, Wissen und Demut, Handlung und Rückzug. Genau diese Balance vermisse ich oft in der aktuellen KI-Debatte. Vieles wirkt getrieben von Machbarkeit, von Märkten, von einem Glauben an die Unvermeidlichkeit technologischer Entwicklung. Doch was, wenn wir uns bewusst dagegen entscheiden – nicht aus Angst, sondern aus Einsicht?
Für mich bedeutet das: Wir brauchen mehr Räume, in denen Technologie nicht nur entwickelt, sondern auch befragt wird. Räume, in denen nicht nur Ingenieur:innen das Sagen haben, sondern auch Philosoph:innen, Theolog:innen, Künstler:innen – Menschen, die sich nicht nur mit dem Wie, sondern auch mit dem Warum beschäftigen. Der Golem erinnert mich daran, dass jedes technische System auch eine ethische Geschichte erzählt. Und dass es an uns liegt, ob wir diese Geschichte mit Sinn füllen – oder sie irgendwann von selbst zu sprechen beginnt.
Erkennen wir die Risiken in hinreichender Weise?
Ich erlebe es immer wieder: Während in Fachkreisen intensiv über die Risiken von KI diskutiert wird – von algorithmischer Voreingenommenheit bis hin zu Kontrollverlust über autonome Systeme –, scheint die breite Öffentlichkeit zwischen Faszination und Gleichgültigkeit zu schwanken. Viele nehmen KI vor allem als praktische Unterstützung wahr: Navigationshilfen, Sprachassistenten, automatisierte Übersetzungen. Sie sind bequem, hilfreich – und wirken harmlos. Die Komplexität hinter diesen Anwendungen, die möglichen gesellschaftlichen Folgen, bleiben meist unsichtbar.
Was mir Sorge bereitet, ist diese Diskrepanz zwischen technischer Realität und gesellschaftlichem Bewusstsein. KI ist längst nicht mehr nur ein Werkzeug, sondern beeinflusst Entscheidungsprozesse in Justiz, Medizin, Bildung, Sicherheit. Und doch sprechen wir selten darüber, wie Macht sich dabei verschiebt – von Menschen zu Systemen, von öffentlichen Institutionen zu privaten Konzernen, von sichtbaren Regeln zu undurchsichtigen Algorithmen.
Der Golem-Mythos kann hier eine wertvolle Funktion erfüllen. Er bringt etwas zur Sprache, das Zahlen und Modelle oft nicht ausdrücken können: die emotionale und moralische Dimension von Schöpfung. Geschichten wie die des Golems berühren etwas in uns, das tiefer geht als rationale Analyse – sie zeigen, wie eine wohlmeinende Idee kippen kann, wie Schutz zu Bedrohung wird, wenn die Kontrolle verloren geht. Diese narrative Kraft könnte helfen, auch KI wieder als das zu begreifen, was sie ist: ein menschliches Produkt, das uns selbst reflektiert – mit all unserer Klugheit, aber auch unseren blinden Flecken.
Ich wünsche mir deshalb mehr interdisziplinäre Perspektiven, mehr kulturelle und spirituelle Stimmen im Diskurs. Denn Technik allein kann nicht beantworten, was als „richtig“ gilt. Diese Fragen betreffen unser Menschenbild, unser Verhältnis zur Welt, unsere Bereitschaft, Verantwortung zu tragen. Wenn wir ernst nehmen, was Talmud und Kabbala lehren – dass wahre Schöpfung nur aus innerer Reife heraus gelingen kann – dann könnten wir auch KI nicht mehr allein nach Effizienz oder Innovationsgrad bewerten, sondern nach ihrer Wirkung auf das Gemeinwohl.
Die eigentliche Herausforderung liegt für mich nicht in der Technik selbst, sondern in unserer Bereitschaft, uns ehrlich mit ihren Konsequenzen auseinanderzusetzen. Es braucht Mut, nicht nur voranzugehen, sondern auch innezuhalten. Der Golem mahnt uns genau dazu. Und vielleicht ist das in unserer Zeit der rasanten Entwicklung der mutigste Schritt von allen.
Technologie und Mythos: Warum wir Geschichten brauchen
In Gesprächen über Technologie stoße ich immer wieder auf die Annahme, dass Geschichten wie die vom Golem heute überholt seien – Relikte aus einer Zeit, in der Menschen sich das Unerklärliche durch Magie oder Religion erklärten. Aber je mehr ich mich mit diesen Mythen beschäftige, desto mehr wird mir klar: Sie sind zeitlos. Nicht, weil sie wörtlich genommen werden müssen, sondern weil sie archetypische Fragen stellen, die auch im Zeitalter der Algorithmen nichts an Relevanz verloren haben.
Mythen wie der Golem sind verdichtete Kulturtexte. Sie sprechen über Verantwortung, Hybris, Macht – nicht abstrakt, sondern konkret, in Bildern und Figuren, die emotional wirken. Und gerade in einer Welt, die zunehmend von abstrakter Technologie geprägt ist, brauchen wir solche Bilder. Sie helfen uns, das scheinbar Technische zu humanisieren, das Komplexe zu begreifen, das Unsichtbare sichtbar zu machen.
Ich erlebe oft, dass Menschen bei Begriffen wie „Machine Learning“ oder „künstliche neuronale Netze“ abschalten – zu technisch, zu weit weg. Aber wenn ich erzähle, dass es Geschichten gibt wie die vom Golem, die genau dieselben Themen verhandeln, öffnet sich oft etwas. Plötzlich wird Technologie nicht nur als Werkzeug gesehen, sondern als Spiegel. Plötzlich geht es nicht mehr nur um Effizienz, sondern um Ethik, nicht nur um Leistung, sondern um Bedeutung.
Technik ist nie neutral – das habe ich durch solche Erzählungen erst wirklich verstanden. Sie trägt immer die Handschrift derer, die sie entwickeln: ihre Werte, ihre Interessen, ihre blinden Flecken. Und je mehr unsere Technologien menschenähnliche Eigenschaften annehmen – sei es Sprache, Entscheidungsfähigkeit oder „Verhalten“ –, desto drängender wird die Frage, wie wir mit dieser Ähnlichkeit umgehen. Erkennen wir uns darin wieder? Oder geben wir etwas auf, das uns menschlich macht?
Für mich sind Mythen wie der Golem deshalb kein sentimentaler Rückgriff, sondern eine kulturelle Ressource. Sie erinnern uns daran, dass Fortschritt nicht nur eine Frage von Innovation ist, sondern auch von Orientierung. Dass wir Geschichten brauchen, um zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Und dass vielleicht gerade jene Erzählungen, die am ältesten sind, uns am klarsten zeigen, was es heißt, Mensch zu sein – in einer Welt, in der Maschinen immer menschlicher erscheinen.
Fazit: Der Golem lebt – und wir sind seine Schöpfer
Je länger ich mich mit dem Golem beschäftige, desto mehr begreife ich ihn als lebendige Idee – nicht als Figur aus Lehm, sondern als Denkform. Er begegnet mir heute in digitaler Gestalt: in den Algorithmen, die uns bewerten, in den Sprachmodellen, die uns antworten, in den Systemen, die scheinbar klüger werden, je mehr wir sie nutzen. Der Golem ist kein Relikt, sondern eine Chiffre für all jene Technologien, die wir geschaffen haben – ohne sie ganz zu durchschauen. Und deren Auswirkungen längst über unsere Bildschirme hinausreichen.
Was mir dabei zunehmend bewusst wird: Es geht nicht mehr um die Frage, ob wir solche Systeme entwickeln sollten – sie sind da, sie wirken, sie verändern unser Leben. Die entscheidende Frage lautet heute: Wie gestalten wir den Umgang damit? Welche Grenzen setzen wir? Welche Werte schreiben wir hinein – und welche lassen wir außen vor? Der Mythos des Golems zwingt uns, diese Fragen nicht zu verdrängen, sondern sie in den Mittelpunkt zu stellen. Denn sobald wir uns der Illusion hingeben, alles unter Kontrolle zu haben, beginnt der Kontrollverlust.
Für mich liegt in dieser Erzählung eine große Verantwortung – aber auch eine Chance. Der Golem ist ein Mahnmal dafür, dass jede Schöpfung auch eine Rückwirkung hat. Dass Technologie nie isoliert existiert, sondern in Beziehungen wirkt: zu uns selbst, zu anderen, zur Gesellschaft. Wenn wir diesen Zusammenhang ernst nehmen, können wir vielleicht eine neue Haltung entwickeln – eine, die nicht auf Beherrschung, sondern auf Verstehen zielt. Eine, die nicht nur auf Effizienz, sondern auf Sinn achtet.
Der digitale Golem ist ein Kind unserer Zeit – geboren aus Daten, trainiert durch Interaktion, gespeist von unseren Fragen, Wünschen, Vorurteilen. Er trägt unsere Handschrift. Und genau deshalb liegt es an uns, ihm Richtung zu geben. Nicht aus Angst, sondern aus Verantwortung. Nicht als Gegner, sondern als Gestalter. Denn letztlich sagt der Golem-Mythos nicht nur etwas über das Risiko des Schöpfens – sondern auch über die Möglichkeit, klüger zu werden, bevor es zu spät ist.

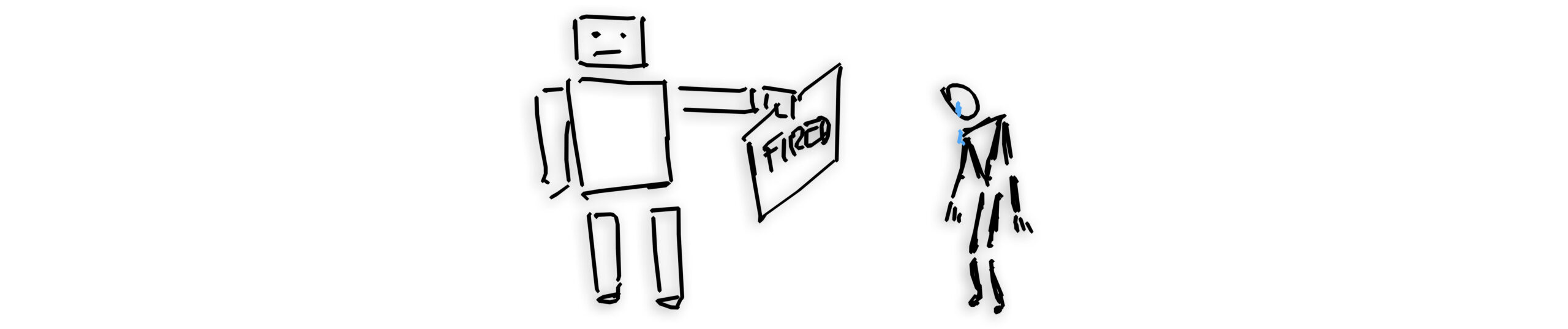
Ich bin vom schaffen weit entfernt. Bei mir ist es eher Goethes Zauberlehrling und die Meister sind verschwunden. Die Geister die ich rief werd ich jetz nicht mehr los. Bildung ist doch was Schönes