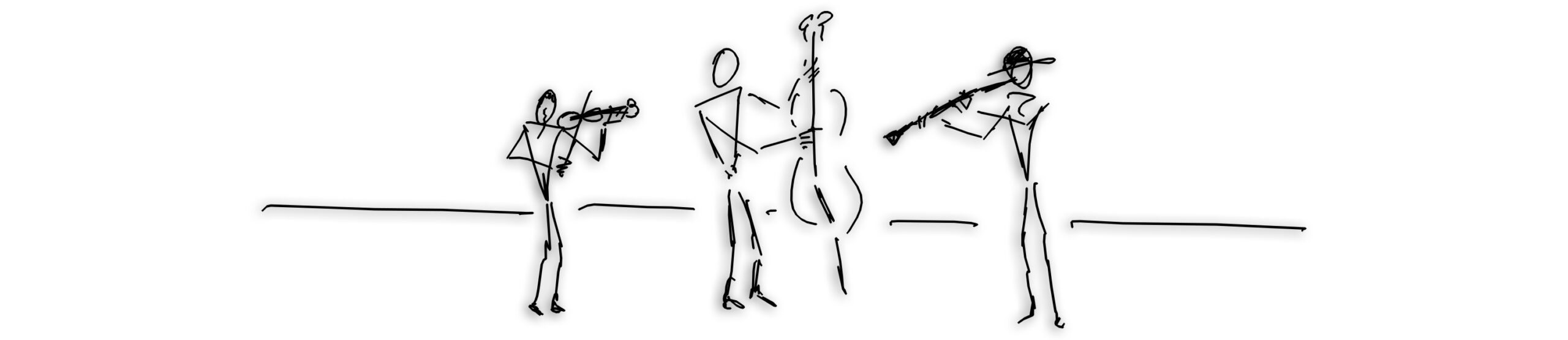Wenn die Nachrichten aus Israel dramatisch und furchtbar sind, wenn Bilder von Gewalt, Angst und Unsicherheit die Schlagzeilen füllen – dann wird es umso wichtiger, nach dem Positiven zu suchen. Und man findet es. Vielleicht nicht laut, nicht plakativ – sondern im Leisen, im Beharrlichen, in der Kultur. Genau hier entfaltet die Klezmer-Musik ihre stille Kraft.
Sie erinnert uns an das, was Menschen selbst in dunkelsten Zeiten mitnehmen konnten: ihre Geschichten, ihre Lieder, ihre Fähigkeit zu feiern. Klezmer ist kein Nostalgie-Souvenir, sondern lebendige Kulturpraxis – auch und gerade heute. Künstler:innen in Israel, den USA, Deutschland, Polen oder Argentinien führen diese Musik weiter. Sie spielen Klezmer auf Bühnen, in Hinterhöfen, in Synagogen oder auf Festivals – und füllen ihn mit neuem Leben.
So bietet Klezmer, was unsere Zeit so dringend braucht: eine Form der Auseinandersetzung, die nicht zerstört, sondern verbindet. Eine Tradition, die Wunden kennt – aber auch den Mut, sie zu zeigen. Und eine Musik, die an das Menschliche erinnert, wenn die Welt unmenschlich erscheint. Vielleicht ist genau das ihre tiefste Bedeutung.
Klezmer ist mehr als Musik – es ist gelebte Geschichte
Klezmer entstand ursprünglich in den jüdischen Gemeinden Osteuropas, insbesondere in den Regionen des heutigen Polen, der Ukraine, Rumänien und Litauen. Der Begriff leitet sich aus dem Hebräischen “kley zemer” ab, was so viel bedeutet wie „Musikinstrumente“ oder „Gefäß des Liedes“. Ursprünglich waren Klezmorim beschäftigte Musiker für Hochzeiten und andere festliche Anlässe, oft wanderten sie zwischen den jüdischen Shtetln – immer mit ihren Instrumenten im Gepäck.
Gefeiert wurde trotz allem: trotz Pogromen, trotz Verdrängung, trotz Diaspora. Klezmer war nie bloß Unterhaltung, sondern eine emotionale Brücke: von Generation zu Generation, von Schmerz zu Hoffnung, von Exil zu Heimat. In ihr verschmolz das, was Juden auf Wanderschaft hörten und erlebten – und das ist immens viel.
Die Klezmorim waren Volkskundler mit Geigen, Klarinetten und Posaunen. Sie beobachteten, hörten zu, nahmen Einflüsse auf und gaben sie musikalisch weiter – stets angepasst an den Anlass, stets improvisierend, stets verbunden mit den Menschen, die sie spielten. Ihre Musik war Erzählung in Klang, ein kollektives Gedächtnis, das sich nicht in Büchern niederschlug, sondern im Moment des Spiels Gestalt annahm.
Ein jüdisches Hochzeitsfest konnte mehrere Tage dauern. Klezmorim waren mehr als Musiker – sie waren Zeremonienmeister, Unterhalter, Vermittler zwischen Braut und Bräutigam, zwischen religiöser Tradition und weltlicher Freude. Ihre Improvisationskunst war legendär, ihre Fähigkeit, Emotionen in Klang zu verwandeln, Ausdruck einer tiefen Verbindung zu den Alltagserfahrungen der jüdischen Bevölkerung.
Sie lebten an den Rändern – gesellschaftlich und geografisch. Und sie verbanden diese Ränder: mit Melodien aus der rumänischen Zigeunermusik, mit Rhythmen der slawischen Folklore, mit arabischen Skalen und türkischen Harmonien, mit chassidischen Gesängen und jiddischer Poesie. So wurde Klezmer zur klingenden Landkarte eines kulturellen Dazwischen – eines Lebens in Bewegung.
Und dieses Leben war oft bedroht. Die jüdische Geschichte Europas ist geprägt von Vertreibung, von Gewalt, von immer neuer Anpassung. Doch anstatt zu verstummen, musizierten die Klezmorim weiter – wandelnd, tragend, bewahrend. Ihre Musik war ein Gegenentwurf zum Vergessen. Ein Zeichen: Wir sind noch da. Hört uns zu.
Selbst als mit der Shoah ein zivilisatorischer Bruch unaussprechlichen Ausmaßes über das europäische Judentum hereinbrach, überdauerte die Klezmermusik. Oft nur in Fragmenten, auf alten Schallplatten, in Melodien, die Überlebende sich ins Exil mitnahmen. Aber sie war da – und sie kehrte zurück. Seit den 1970er Jahren haben Musiker:innen unterschiedlichster Herkunft begonnen, diese Musik neu zu entdecken. In Berlin, in Brooklyn, in Krakau wird Klezmer wieder gespielt, gelehrt, gefeiert. Als Erinnerung, als Gegenwart, als Zukunft.
In diesem Sinne ist Klezmer nicht nur Musik. Es ist gelebte Geschichte – vibrierend zwischen Tradition und Gegenwart. Es ist Klang gewordene Erinnerungskultur. Und ein lebendiges Zeugnis für die kulturelle Resilienz eines Volkes und seiner Kraft, unter den Bedingungen von Flucht und Verfolgung dennoch Schönheit zu schaffen.
Ein genuines Klangkonglomerat: musikalische Verschmelzung über Grenzen hinweg
Kaum eine Musikrichtung verkörpert kulturelle Hybridität so konsequent wie Klezmer. Die Musik absorbierte über Jahrhunderte hinweg verschiedenste Einflüsse – nicht aus Beliebigkeit, sondern aus gelebter Notwendigkeit. Die jüdischen Gemeinden Osteuropas lebten in ständiger Bewegung, geografisch wie kulturell. Ihre musikalische Sprache war immer auch ein Spiegel dieser Mobilität, dieser Durchlässigkeit, dieser kreativen Aneignung und Weitergabe.
- Osteuropäische Volksmusik: Slawische Tänze wie die Polka, russische Weisen oder ukrainische Kolomyjka prägten den rhythmischen Fundus der Klezmermusik. Besonders auffällig ist die enge Verwandtschaft zur rumänischen Hora, oft in ungeraden Taktarten wie 7/8 oder 9/8, die im Klezmer in angepassten, tanzbaren Varianten auftaucht. Diese Rhythmen sind vital, dynamisch und oft treibend.
- Osmanische Einflüsse: Besonders jüdische Gemeinden auf dem Balkan hatten kulturellen Austausch mit der Musik der osmanischen Welt. Ornamentierungen wie das Krekhts (ein kehliger Ton, fast wie ein Weinen) oder Mikrointervalle in der Melodieführung zeigen Nähe zu türkischen und griechischen Tonmodellen. Häufig verwendet wird der Freygish-Modus – eine phrygische Skala mit erhöhter Terz, die typisch für sefardische wie auch arabische Musik ist und eine besondere Spannung zwischen Wehmut und Feierlichkeit schafft.
- Roma-Musik: Besonders enge Verbindungen bestehen zur Roma-Tradition. Wandermusiker aus Roma-Familien und jüdische Klezmorim spielten oft gemeinsam bei Festen oder in dörflichen Ensembles. Der virtuose Geigengesang, das freie Rubato-Spiel und schnelle ornamentierte Läufe zeigen stilistische Nähe. Improvisation wurde zur gemeinsamen Sprache zwischen durch Gesetz und Gesellschaft marginalisierten Gruppen.
- Chassidische und liturgische Gesänge: Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss religiöser Musik. Viele Klezmer-Melodien haben ihren Ursprung in Nigunim, geistlichen Gesängen ohne Worte, deren repetitive Struktur die ekstatische Gotteserfahrung unterstützen sollte. Diese spirituelle Tiefe gibt dem Klezmer seine doppelte Emotionalität: sowohl ekstatisch als auch meditativer Ausdruck.
- Später: Jazz und Swing: Mit der Emigration jüdischer Musiker:innen nach Amerika – besonders nach New York – verschmolz Klezmer mit dem aufkommenden Jazz. Die Klarinette übernahm Triumphzüge, aus der Begleitung wurde Improvisation, aus der traditionellen Hora ein Swing-Stück. Namen wie Dave Tarras oder Naftule Brandwein stehen exemplarisch für diese Transformation.
All diese Einflüsse haben den Klezmer nicht verwässert – im Gegenteil. Sie haben ihn geprägt, verdichtet und in eine eigenständige Form verwandelt. Eine Form, die gerade in ihrer Vielstimmigkeit so kraftvoll wird. Der Klezmer ist ein Klangnetzwerk der jüdischen Idee des Dialogs: zwischen Ost und West, Tradition und Moderne, Klage und Tanz.
Wer heute Klezmer hört, hört daher nicht nur jüdische Musikgeschichte – sondern globale Musikgeschichte. Sie ist das frühe Beispiel einer Weltmusik, lange bevor dieser Begriff erfunden wurde. Und sie mahnt uns: Kulturen leben nicht durch Abgrenzung, sondern durch Austausch. Inmitten aller Unterschiede entscheidet die Haltung, mit der man einander begegnet. Klezmer begegnet offen, emotional, unerschrocken. Und darin liegt seine Aktualität.
Mobile Instrumente: Ausdruck ständiger Fluchtbereitschaft
Die Instrumentierung von Klezmer ist auffallend mobil. Keine Kirchenorgeln, keine großen Trommeln – sondern Klarinette, Geige, Akkordeon, kleine Trommel, Zimbel und später auch das Banjo oder das tragbare Bassinstrument Tuba. Alles passt in ein Bündel. Alles ist transportabel. Das ist kein Zufall – es ist kulturelle Praxis unter Druck. Die jüdischen Musiker lebten in einer Realität, in der Vertreibung, Umsiedlung oder staatliche Repression jederzeit drohen konnten. Die Musik musste reisen können. Und sie tat es – wortwörtlich auf dem Rücken derer, die sie spielten.
Im osteuropäischen Schtetl arbeiteten Klezmorim unter prekären Bedingungen. Oft galten sie als Außenseiter – sowohl innerhalb wie außerhalb der jüdischen Gemeinden. Ihre Kunst brachte zwar Anerkennung, aber selten Sicherheit. Sie wanderten durch Dörfer, spielten bei Familienfesten, pogromartig unterbrochene Hochzeiten, religiöse Zeremonien. Immer war ein Aufbruch in Reichweite. Und so ist die Auswahl der Instrumente auch pragmatisch zu verstehen: tragbar, robust, vielseitig einsetzbar. Die Musik selbst wurde zur Überlebensstrategie.
Besonders prägnant ist die Rolle der Klarinette. Sie wurde zur „Stimme“ des Klezmer – weil sie etwas kann, was kein anderes Blasinstrument in gleicher Weise schafft: klagen wie der Mensch, weinen, lachen, stottern, schreien, wispern. In der Klarinette finden sich die emotionalen Register einer Sprachgemeinschaft, die ihre Identität nie nur im Wort, sondern im Klang ausdrückte. Von schnellen Tanzläufen bis zu langgezogenen, sehnsüchtigen Melodiebögen – die Klarinette ist das Instrument der Mehrdeutigkeit, des offenen Ausdrucks.
Die Geige steht ihr in Expressivität kaum nach. Virtuos und warm, tragfähig für Soli oder Begleitung, war die Geige das bevorzugte Instrument vieler osteuropäischer Volksmusiker – auch unter Roma- und Klezmer-Spielern. Hier begegnet sich das Melancholische mit dem Maßlosen, das Tröstliche mit der Ekstase.
Das Akkordeon – später eingeführt – brachte ein tragbares Harmonieinstrument, das melodisch und rhythmisch zugleich agieren konnte. Es ersetzte teilweise das ursprünglich gespielte Cymbalom oder Hackbrett, das schwieriger zu transportieren war. Auch das Banjo in der späteren Klezmer-Jazz-Szene der USA passt in dieses Bild: leicht, laut, dynamisch. Es wurde bald in städtischen jüdischen Orchestern und Hochzeitskapellen beliebt.
Diese Mobilität der Instrumente wurde vom Sound begleitet: eingängige Melodien, klarer Rhythmus, flexible Form. Im Zentrum: der Moment, die Gemeinschaft, das Spiel mit der Emotion – improvisiert und zugleich durchdrungen von Tradition. Kein schweres Gerät, keine fixierte Partitur, sondern lebendige Musikkultur im permanenten Ausnahmezustand.
Mit jedem Aufbruch, mit jedem Exil nahm diese Musik einen neuen Ort auf. Und so steht die Instrumentierung des Klezmer nicht nur für Fluchtbereitschaft und Pragmatismus, sondern auch für seine Offenheit, seine Anpassungsfähigkeit – ohne dabei seine Identität zu verlieren. Der Klang blieb jüdisch, auch wenn die Luft ständig eine andere war.
Sprachenvielfalt: Klangliche Identität über Worte hinaus
Die gesungenen Teile der Klezmer-Musik (z. B. in den Yiddish Lieder) offenbaren eine bemerkenswerte Sprachlandschaft. Klezmer ist nicht nur ein Klanggebilde – es ist auch ein linguistischer Spiegel einer jahrhundertelangen, transkulturellen Existenz. Die Vielzahl der Sprachen, die in Texten, Melodien und Ausdrucksmustern auftauchen, ergibt ein faszinierendes Mosaik – ein Echo der jüdischen Diaspora zwischen Ost und West, Tradition und Moderne.
- Jiddisch: Die Herzsprache vieler Aschkenasim, entstanden im Mittelalter in den deutschsprachigen Gebieten und über Jahrhunderte angereichert mit hebräischen, aramäischen, slawischen und romanischen Einflüssen. Jiddisch ist mehr als ein Kommunikationsmittel – es ist ein emotionaler Resonanzraum, durch den jüdischer Alltag, Humor, Weisheit und Schmerz klingen. Jiddische Liedtexte erzählen ironisch vom Elend, feiern das Leben in der Küche, in der Kehilla, auf der Straße. Das berühmte „Bei mir bistu sheyn“ zeigt, wie Jiddisch sogar globalen Jazz-Hitstatus erlangte.
- Hebräisch: Als sakrale Sprache ist Hebräisch besonders in religiösen Liedformen präsent – etwa im Rahmen von Sabbat-, Hochzeits- oder Chanukkagesängen, aber auch in chassidischer Musik. Die gesungene Wiederholung von Versen, das intonierte Gebet, die rituelle Melodie – sie alle verbindet Hebräisch mit einer zeitlosen, spirituellen Dimension des Klezmer.
- Lokale Sprachen: Juden lebten nie isoliert – ihre Sprache war immer in Beziehung. Ob Russisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch oder Ladino (im Falle sefardischer Einflüsse): Regionale Sprachen färbten Aussprache, Rhythmus und Textfragmente in Liedern. In multikulturellen Städten wie Lemberg, Czernowitz oder Wilna war ein polyglotter Alltag normal – und fand Eingang in die Musik.
Doch bemerkenswerterweise bedarf Klezmer gar nicht zwingend der Worte, um zu kommunizieren. Die Instrumentalmusik selbst spricht. In ihren Phrasierungen, ihren Ornamentierungen und ihrer Struktur liegt eine innere Grammatik: Frage und Antwort, Emphase, Relativsatz, Ausrufezeichen. Der musikalische Duktus folgt einer erzählenden Logik – eine Struktur, die an das gesprochene Wort erinnert, ohne es zu benötigen.
Insbesondere die Klarinette imitierte häufig den jiddischen Sprachduktus. Musiker wie Naftule Brandwein oder Dave Tarras entwickelten Spielweisen, die an Lachen, Weinen, Nuscheln oder gar Streitgespräche erinnern. Wer Klezmer hört, vernimmt eine Klangsprache, die sich zwischen Ton und Ton entscheidet, zwischen Moll und Dur modulierend erzählt – wie ein Gespräch bei Kerzenlicht.
Diese Klangsprache bildet nicht nur Identität ab – sie schafft sie. Gerade weil jüdische Communities im Exil oft ohne beständigen geografischen Ort existierten, wurden Sprache und Musik zu einem mobilen Dach – einem „klingenden Zuhause“, das über Landes- und Sprachgrenzen hinaus verstanden werden konnte. Klezmer ist gelebte Mehrsprachigkeit – instrumentiert, intoniert, improvisiert.
Und so klingt diese Musik noch heute wie ein Gespräch über Zeit und Raum hinweg: zwischen den Stimmen der Vergangenheit und denen der Zukunft, zwischen Erinnerung und Erneuerung. Klezmer ist nicht stummes Archiv, sondern klingende Vielfalt – voller Geschichten, Zwischentöne und Schmerz, aber auch mit einem unerschütterlichen Sinn für Humor und Lebensfreude. Selbst – oder gerade – in Moll.
Lebensfreude – auch in Moll
Was Klezmer so einzigartig macht, ist die Fähigkeit zur Koexistenz von Emotionen. Eine Melodie beginnt wehmütig, kippt ins Heitere, lacht, obwohl sie gerade noch weinte. Moll ist kein Gegensatz zu Freude – im Klezmer ist es ihr tragendes Gewand. Die Musik hält Gegenteiliges in der Schwebe, ohne zu werten. Schmerz und Lust, Verlorenes und Gelebtes, alles darf gleichzeitig da sein. Das ist keine emotionale Instabilität, sondern eine tiefe Lebenserkenntnis.
Klezmer schwingt zwischen Licht und Schatten, weil jüdische Geschichte genau das ist – eine unablässige Bewegung zwischen Hoffnung und Erfahrung, zwischen Mythos und Messbarkeit. In dieser Musik hört man nicht nur den Einzelnen, sondern auch das kollektive Gedächtnis: Es jammert nicht, sondern seufzt mit Witz. Es trauert nicht nur – es tanzt dabei. Und genau das ist es, was Menschen seit Generationen anzieht, berührt, überrascht.
Der berühmte Klarinettist Giora Feidman sagte einmal: „Klezmer ist die Musik der Seele.“ Eine Seele aber ist kein linearer Fortgang. Sie springt, zögert, lacht, obwohl sie fallen will. Insofern ist das Moll in der Klezmermusik nicht als düster zu verstehen, sondern als schwebender Grundton, der alles trägt – auch, wenn die Freude tanzt.
So kann ein Stück wie „Doina“ erst meditativ stocken, dann explosiv in die „Freylekhs“ übergehen. Der Tempowechsel ist nicht Effekt – er ist Aussage: das Leben kann jederzeit kippen. Die tiefere Botschaft: Lebe jetzt. Fühle alles. Feier trotzdem. Auch wenn du nicht weißt, wie lange.
In einer Welt, die sich mit binären Denkmustern schwertut – traurig oder fröhlich, fremd oder heimisch, wir oder sie – liefert Klezmer ein Gegenangebot: die Gleichzeitigkeit des Uneindeutigen. Moll als Freude, Euphorie als Erinnerung, Tradition als Neuanfang. Genau darin liegt die Modernität dieser alten Musik.
Vielleicht ist das Klezmers größte Gabe: uns an etwas Immaterielles zu erinnern, das in Zeiten von Krise, Krieg und Unsicherheit umso dringender gebraucht wird – an die Fähigkeit, mit gebrochenem Herzen zu tanzen. Weil Musik das erlaubt, was das Leben manchmal verweigert: Hoffnung trotz allem.
Warum Klezmer so oft in Moll erklingt – und trotzdem tanzt
Der hohe Anteil an Moll-Tonarten in der Klezmer-Musik ist kein Zufall – und auch kein Widerspruch zur oft mitreißenden, lebensfreudigen Energie dieser Musik. Im Gegenteil: Moll ist im Klezmer kein Ausdruck von Resignation, sondern ein Schlüssel zur Tiefe. Die Melancholie, die mitschwingt, ist gelebte Erinnerung, nicht Trauer um ihrer selbst willen. Und oft kippt die Stimmung ganz bewusst vom Wehmütigen ins Mitreißende – wie das Leben selbst. Diese Wechselhaftigkeit ist keine Laune, sondern ein bewusstes musikalisches Stilmittel.
Ein zentrales Element sind dabei die für Klezmer typischen Modi – Tonleitern mit ost- und südosteuropäischen Einflüssen, die sich von der klassischen Dur/Moll-Dualität westlicher Musik weit entfernen und ihren ganz eigenen Ausdruck formen.
Charakteristische Tonarten und Modi in Klezmer-Musik
- Freygish (auch Ahava Rabbah-Modus):
Diese Skala erinnert an das harmonische Moll, ist aber durch die erhöhte zweite Stufe (zum Beispiel E♭–F♯) besonders charakteristisch. Sie bringt eine klagende, zugleich intensive Klangfarbe mit sich und ist eine der wichtigsten modalen Grundlagen für viele klassische Tanzformen wie Freylekhs und Bulgars. Trotz ihres „orientalisch“ empfundenen Klangs wirkt sie nicht fremd, sondern emotional greifbar: tief, dramatisch, tanzbar. - Misheberakh-Modus:
Dieser Modus bewegt sich zwischen dorischer und harmonisch-mollartiger Struktur – und eröffnet damit einen großen Gestaltungsspielraum. Er wird besonders häufig in festlichen oder spirituell geprägten Stücken verwendet und bietet zahlreiche Möglichkeiten für improvisatorische Ausformung. - Moll-Tonarten im Allgemeinen:
Viele Klezmer-Stücke, insbesondere freie Formen wie Doina, Hora oder Taksim, sind eindeutig im Moll verankert. Dabei kommen sowohl natürliches als auch melodisches Moll zur Anwendung – ergänzt durch reiche Verzierungen, Glissandi und expressive Phrasierungen, die den Ton in Bewegung halten. Die Moll-Skalen werden hier nicht als begrenzend empfunden, sondern eröffnen Tiefe und Ausdruck.
Wie viel Moll steckt wirklich in Klezmer?
Auch wenn keine offizielle Statistik existiert, lassen sich aus musikwissenschaftlicher Literatur sowie der Praxis folgendes ableiten: Der überwiegende Teil des traditionellen Klezmer-Repertoires – schätzungsweise 70 bis 80 Prozent – verwendet Moll-Tonarten oder mollverwandte Modi wie Freygish. Besonders Tanzstücke und instrumentale Improvisationen greifen auf diese Klangbereiche zurück. Dur-Tonarten hingegen kommen seltener vor und werden vor allem bei eher heiteren und rhythmisch-kompakten Tänzen wie Sher oder Temposchlussstücken eingesetzt.
Der Moll-Charakter ist also nicht Zeichen von kultureller Schwermut, sondern Ausdruck einer Emotionalität, die sich weigert, sich auf eine Stimmung festzulegen. Moll erlaubt die Bewegung zwischen Wehmut und Euphorie – genau das ist der Kern des Klezmer.
Empfohlene Literatur und Quellen
- Joel E. Rubin: New York Klezmer in the Early Twentieth Century – fundierte Analyse über Spielpraktiken und Modalität. Routledge
- Walter Zev Feldman: Klezmer: Music, History and Memory – umfangreiche Kontextualisierung der musikalischen und historischen Entwicklung. Oxford University Press
- The Klezmer Fake Book – enthält viele analysierbare Beispiele aus dem traditionellen Repertoire. Hal Leonard
Moll-Fazit
Klezmer ist Musik „in Moll“ – aber nicht im Sinne von Traurigkeit, sondern als musikalischer Raum voller Möglichkeiten. Die modalen Strukturen erlauben sowohl tiefe Emotionalität als auch explosive Lebensfreude – manchmal in einem einzigen Stück, ja in einem einzigen Takt. Moll steht hier nicht für Melancholie, sondern für Tiefe. Und gerade deshalb ist Klezmer bis heute so bewegend: weil sie sich nicht auf eine Emotion festlegen lässt, sondern die ganze Bandbreite menschlicher Erfahrung hörbar macht – ohne Filter, aber voller Gefühl.
Hörtipps – so klingt Klezmer heute
- Die Klezmer Akademie – lebendige Traditionspflege.
- Giora Feidman – der Großmeister der Klarinette, Botschafter der „Fröhlichkeit in Moll“.
- The Cracow Klezmer Band – moderne Adaptionen mit Jazz-Elementen.
Fazit
Klezmer ist mehr als Musik – sie ist ein kulturelles Gedächtnis, eine emotionale Sprache, ein beweglicher Anker. Von den Gassen Osteuropas bis zu Konzertbühnen weltweit: Klezmer erinnert daran, was Menschen trägt, wenn sie nichts mehr mitnehmen können – außer vielleicht einer Melodie in Moll.
In ihren oft improvisierten Melodien liegt das kollektive Gedächtnis eines Volkes, das viel erlitten, aber nie aufgehört hat zu feiern, zu erzählen, zu leben. Klezmer bringt Gegensätze in Einklang: Stille und Lachen, Klage und Tanz, Moll und Lebensfreude. Gerade in einer Zeit, in der das Weltgeschehen wieder Unsicherheit schürt, gelingt es dieser tief verwurzelten Musikform, Licht zu sein – manchmal ganz leise, manchmal wild und ekstatisch, immer menschlich.
Und so ist jede Klezmer-Melodie ein vermittelnder Zwischenraum: zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Identität und Offenheit, zwischen Erinnerung und Gegenwart. Ihre Instrumente sind tragbar, aber ihre Wirkung ist gewaltig. Wer Klezmer hört, hört nicht nur Musik – er hört Geschichte, Lebenskunst und Überlebenswillen.
Wehmut kann tanzen – Klezmer hat das bewiesen.