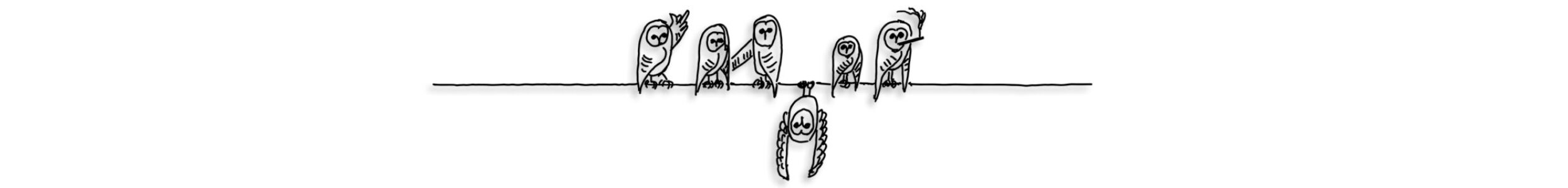Von wegen Modeerscheinung – was viele als neue Welle psychologischer Selbstinszenierung abtun, ist in Wahrheit ein Spiegel unserer wachsenden diagnostischen Kompetenz. Doch zwischen Social-Media-Selbsthilfe und Fachärzte-Facepalm braucht es dringend eines: Klarheit.
Willkommen im Club der „Modekranken“
Da scrollt man also durch Instagram, TikTok und Co und merkt: Die halbe Welt scheint plötzlich ADHS zu haben. Oder Autismus. Oder irgendwas dazwischen.

„Modediagnose!“ rufen die einen, „endlich Aufklärung!“ die anderen. Dazwischen: ein Meer aus Selbstdiagnosen, Pseudotherapien und ratlosen Kommentaren von Menschen, die irgendwo zwischen Symptombingo und Selbstfindung hängen.
Und während Social Media die Vielfalt des Gehirns feiert, rollen in Wartezimmern Ärztinnen und Therapeuten gelegentlich mit den Augen. Als ob Neurodivergenz ein Influencer-Filter wäre. Ironischerweise kommen viele dieser Augenroller aus eben jenen Fachkreisen, die jahrelang dazu beitrugen, dass solche Diagnosen überhaupt selten gestellt wurden. Das nenne ich dann wissenschaftliches Gaslighting mit Stil.
Die Sache mit den steigenden Diagnosen
Beginnen wir mit dem wohl häufigsten Aufreger: „ADHS gibt’s heute ja an jeder Ecke! Jeder zweite hat das doch!“ – Oft gehört, nie durchdacht. Wer ein Thermometer kauft, wird auch häufiger Fieber entdecken. So einfach ist das.
Mit steigendem Bewusstsein für neurodivergente Phänomene – nennen wir es ruhig: mehr Wissen über das Gehirn – steigt zwangsläufig auch die Zahl der Diagnosen. Dasselbe Prinzip gilt für jede medizinische Erkenntnis: Seit man MRTs erfunden hat, sind Hirntumore nicht häufiger geworden, nur sichtbarer.
Diagnosesysteme wie der DSM-5 oder die ICD-11 spezifizieren ihre Kriterien, passen Grenzwerte an und schaffen damit – Überraschung – mehr Präzision. Und Präzision heißt manchmal: mehr Treffer. Ob das ein Problem ist? Nur dann, wenn man lieber in Unwissenheit lebt.
Die gestiegene Zahl diagnostizierter neurodivergenter Menschen ist also kein Zeichen einer „Mode“, sondern ein statistisches Echo unserer verbesserten Wahrnehmung. Wir sehen endlich, was schon immer da war – wir hatten vorher nur keine Brille dafür.
Oder anders gesagt: Sterne waren auch schon da, bevor Galileo sein Fernrohr auspackte. Nur geglaubt hat’s halt keiner.
Neurodiversität als Krankheit? – Eine unpraktische Hypothese
Wenn man sich den durchschnittlichen Feuilleton-Kommentar zu „neuen psychischen Moden“ ansieht, entdeckt man dort oft die Frage: „Seit wann ist Anderssein eigentlich eine Krankheit?“
Eine berechtigte, aber schlecht gestellte Frage. Denn Neurodiversität ist kein Virus, der durch WLAN übertragen wird. Sie ist ein Spektrum menschlicher Verschaltung, ein evolutionäres Produkt – und vermutlich sogar ein Vorteil.
ADHS etwa wird oft als chronischer Dopaminmangel beschrieben. Das ist vermutlich medizinisch korrekt, aber intellektuell unvollständig. Denn daran schließt sich die eigentliche Frage an: Wenn Millionen Menschen weltweit „zu wenig Dopamin“ haben – ist dann die Menschheit kaputt? Oder das Modell, an dem wir sie messen?
Schaut man historisch, wird’s spannend. Viele Genies, Künstler, Forscher (und, ja, Chaos-Menschen) zeigen heute in der Retrospektive Merkmale neurodivergenter Strukturen – vom Sir Isaac Newton bis zu Nikola Tesla.
Neurodiversität ist so alt wie die Menschheit selbst; sie ist in den Genen, nicht in den Timelines. Wäre sie ein Fehler, hätte die Evolution sie längst aussortiert. Stattdessen hat sie ihr eine feste Nische gegeben – als kreativer Störfaktor in einer Welt, die allzu gern kontrolliert.
Und doch liegt genau hier die gesellschaftliche Ironie: Damit Neurodivergenz in der heutigen Struktur unseres Gesundheits- und Sozialsystems überhaupt Unterstützung, Hilfsangebote oder Nachteilsausgleiche generieren kann, muss sie formal als Krankheit oder Störung klassifiziert werden.
Ohne diesen Stempel bleibt sie rechtlich unsichtbar – und das bedeutet, keine Therapie, keine Förderung, kein Anspruch auf Zeit, Raum oder Verständnis. Die Pathologisierung ist also weniger ein Urteil über den Wert der Betroffenen, als vielmehr ein administrativer Hebel, um Hilfe ermöglichen zu dürfen. Paradox, aber notwendig.
Welche Gesellschaft käme ohne Querdenker, Impulsgeber, Hyperfokussierte oder Mustererkennungs-Fanatiker aus? Genau. Die mit den Ideen.
Also nein: Neurodiversität ist keine Krankheit. Sie ist eine Perspektive. Nur dass wir kulturell noch nicht gelernt haben, mit ihr klug umzugehen – weil sie nicht in unsere linearen Lehrbuchlogiken passt.
Medikamentation – Zwischen Dämonisierung und Dogma
Und dann gibt’s da noch das große Reizthema: Medikamente. Kaum ein Wort spaltet die Gemüter so sehr wie „Ritalin“. Schon der Begriff liefert Gesprächsstoff für gleich drei Lager: die Verteufler, die Verordner und die Verzweifelten.

Tatsächlich ist die Entscheidung für eine medikamentöse Therapie eine der schwierigsten – vor allem, wenn es nicht um einen selbst geht, sondern um Kinder. Die Vorstellung, den eigenen Nachwuchs mit einem BTM-präparierten Stoff zu behandeln, ruft schnell reflexhafte Abwehr hervor.
„Das Kind ist doch nicht krank!“ heißt es dann, als ginge es um moralische Reinheit, nicht um biochemische Unterstützung.
Aber die Gleichung ist simpel: Wenn ein Gehirn strukturell weniger Dopamin bereitstellt, kann „mehr Anstrengung“ es nicht ausgleichen. So wenig wie man Diabetes durch gutes Zureden heilt. Der Vergleich mit Insulin ist nicht zufällig, er ist präzise.
Natürlich: Medikamente sind keine Zauberkugel. Ihre Wirkung ist individuell, ihre Nebenwirkungen real, und ihre Dosierung eine Wissenschaft für sich. Aber sie pauschal abzulehnen, weil „zu viele Kinder Ritalin kriegen“, ist so sinnvoll, wie Insulin zu verbieten, weil Zuckerschock doof klingt.
Der eigentliche Skandal liegt woanders: in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Medikamente dienen nicht der Anpassung an den Mainstream. Sie sollen den Betroffenen ein inneres Gleichgewicht ermöglichen – Fokus, Ruhe, Teilhabe. Stattdessen reduzieren viele das Ziel auf „Ruhigstellen“, was mehr über unsere Angst vor Abweichung aussagt als über Pharmakologie.
Wenn Meinung Evidenz ersetzt
Je populärer ein Thema wird, desto lauter wird das Halbwissen. Gerade im neurodivergenten Kontext begegnet man erstaunlich vielen „Experten“, die nie einen neuropsychologischen Test gesehen haben, aber genau wissen, dass ADHS „nur schlechte Erziehung“ ist. Ein Klassiker der Küchenpsychologie.
Diese Stimmen existieren auch in der Fachwelt – erschreckend genug. Da diskutieren approbierte Therapeuten öffentlich, ob „das alles nicht nur Social Media“ sei, während gleichzeitig Diagnosen, Studien und Fachliteratur die Komplexität längst belegen. Das Problem ist also weniger das Unwissen, sondern die Arroganz, es nicht zu merken.
Die Konsequenz? Gaslighting im großen Stil. Wer neurodivergent lebt, erlebt diese Form der subtilen Infragestellung täglich: „Bist du sicher, dass du das hast?“ – eine simple Frage, deren Wirkung verheerend sein kann. Denn neurodivergente Menschen reagieren auf Ablehnung, Zweifel oder spöttische Kommentare oft deutlich intensiver, als Neurotypische. Das liegt nicht an übersteigerter Empfindlichkeit, sondern an neurologischer Verstärkung der emotionalen Reize.
Heißt: Der süffisante Spruch „Man kann’s auch übertreiben“ trifft hier härter als gedacht. Vielleicht sollten wir kollektiv wieder lernen, die Klappe zu halten, wenn wir keine Ahnung haben.
Blick hinter die Symptome: Was wirklich zählt
Wer neurodivergente Menschen nur durch das Prisma gesellschaftlicher Störung sieht, versteht weder sie noch die Diagnostik. Eine ADHS-Diagnose bedeutet nicht, dass jemand „kaputt“ ist; sie beschreibt eine andere Art, die Welt wahrzunehmen. Das kann zu Problemen führen – ja –, aber auch zu außergewöhnlichen Begabungen. Hyperfokus ist kein Defekt, er ist ein Turbo, wenn man ihn lenken lernt.
Doch genau das geht in der öffentlichen Wahrnehmung verloren. Die Diagnose wird zur Etikette, nicht zur Erkenntnis. Man feiert oder verflucht sie, statt sie intelligent zu interpretieren. Dabei wäre sie ein Fortschritt – für Betroffene, Fachleute und Gesellschaft, wenn man sie nur als das ansehen würde, was sie ist: ein Werkzeug der Selbst- und Fremdverständigung.
Ein gutes Beispiel: Menschen, die nach Jahren endlich eine ADHS- oder Autismusdiagnose bekommen, berichten oft von einer tiefen inneren Ruhe. Nicht, weil sie plötzlich Medikamente nehmen – sondern weil sie verstehen, warum sie sind, wie sie sind. Diese Art von Selbsterkenntnis kann kein Lob ersetzen, kein Medikament imitieren und keine Therapie erzwingen. Sie ist Befreiung.
Ein Plädoyer für die Differenz
Vielleicht sollten wir aufhören, Neurodiversität in Quantitäten zu messen – wie viele Diagnosen, wie viele Pillen, wie viel Fördertöpfe. Stattdessen könnten wir beginnen, sie qualitativ zu betrachten: Welche Systeme passen sich an wen an? Und warum erwarten wir immer noch, dass der Einzelne sich der Norm beugt, nicht umgekehrt?
Die Evolution hat offensichtlich entschieden, dass Vielfalt im Denken einen Zweck hat. Vielleicht ist dieser Zweck nicht „Funktionieren“, sondern Weiterentwickeln.
Wäre Neurodiversität eine Mode, dann wäre Astronomie auch nur ein Trend seit der Erfindung des Teleskops. Oder Mathematik eine Phase nach dem Rechnenlernen.
Vielleicht – und das ist der eigentliche Gedanke hinter alldem – ist Neurodiversität keine Störung, sondern die Erinnerung daran, dass Komplexität der Normalzustand ist. Nur unsere Gesellschaft will es nicht wahrhaben, weil sie Simplifizierung besser verkauft.
Fazit
Neurodivergenz ist kein Zeitgeistphänomen, keine TikTok-Diagnose und schon gar keine soziale Mode. Sie ist das Ergebnis einer präziseren Diagnostik, einer offeneren Kommunikation und einer langsam wachsenden Bereitschaft, Andersartigkeit nicht nur zu tolerieren, sondern zu verstehen.
Die Diskussion darüber darf gern kritisch sein – aber bitte fundiert. Nicht jedes Kind mit einem Wutanfall braucht Methylphenidat. Nicht jeder Erwachsene mit Chaos im Kalender hat ADHS. Doch ebenso gilt: Nicht jedes abweichende Verhalten ist Faulheit, Überforderung oder Lifestyle.
Es ist höchste Zeit, dass wir die Schublade „Modediagnose“ schließen. Denn die ist – bei Licht betrachtet – das eigentliche Symptom mangelnder Reflexion.
Oder, um es sarkastisch zu sagen: Neurodiversität ist keine Epidemie. Nur die Ignoranz dazu ist viral.