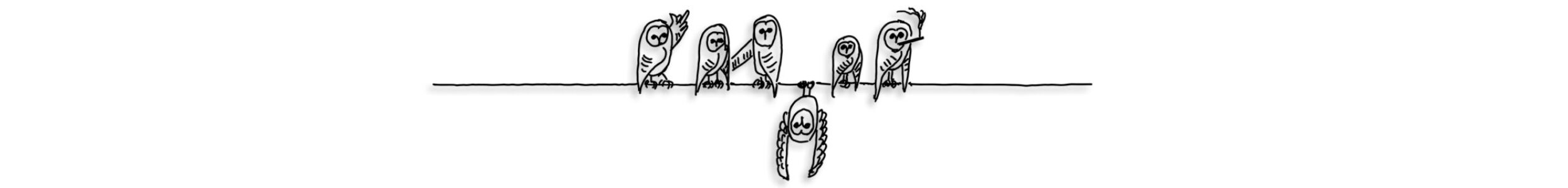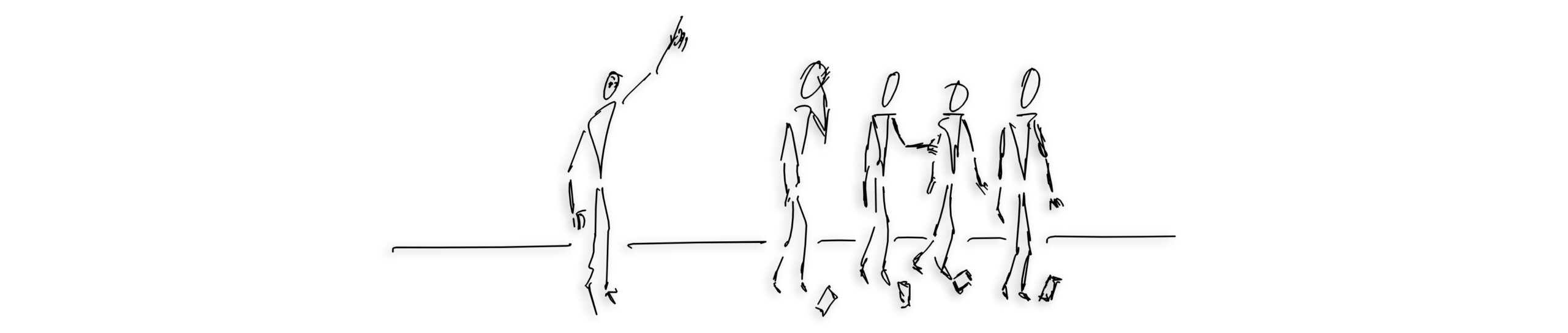Wenn Manager plötzlich Minister spielen, wird Politik zum Business-Meeting mit Flagge. Friedrich Merz hat es gewagt – und Deutschland bekommt die Quittung in Form von PowerPoint-Regierung, KPI-Kabinetten und einem Satz heißer Luft pro Sitzung.
Es klang so verlockend, fast nach einem Renaissanceprojekt der Vernunft. Wirtschaftskompetenz trifft Staatskunst, Effizienz küsst Bürokratie, Rendite rettet das Vaterland. Merz’ Idee: Wirtschaftsbosse als Minister sollen das Kabinett in ein agiles Start-up der Vernunft verwandeln. Doch wer im Konferenzraum applaudiert, verpasst oft, wie draußen die Republik langsam kippt.
Vom Bonus zur Bundeskanzlei
Friedrich Merz’ Idee klingt auf dem Papier charmant. Erfolgreiche Manager sollen endlich frischen Wind in den angestaubten Regierungsapparat bringen. Nur: Wenn der Wind stinkt, hilft auch kein Durchzug.
Warum glaubt man eigentlich immer noch, dass jemand, der 10.000 Leute nach Rendite sortiert, plötzlich das Gemeinwohl versteht? Manager sind trainiert, Kosten zu senken – nicht Krisen zu lösen. Ihr Reflex beim Wort „Defizit“ ist: Leute raus. Blöd nur, wenn die „Leute“ in diesem Fall 83 Millionen Bürger sind. Zwischen BWL und VWL klaffen Welten!
Im Konzern genügt eine Quartalspräsentation, um Vertrauen vorzutäuschen – in der Politik sind vier Jahre ein einziger Stresstest. Ein CEO kann sich versprechen, verlieren, sogar scheitern, solange die Bilanz glänzt. Ein Minister hingegen steht nach jedem falschen Satz am öffentlichen Pranger. Die „Kommunikationsstrategie“, die im Vorstandsjargon gepolt ist auf „Wording“ und „Stakeholder Management“, klingt in einem Wahlkreis schnell wie heiße Luft mit Excel-Randnotiz.
Im Management ist der Kurs klar: Kennzahlen dominieren den Kompass. In der Politik bestehen die Koordinaten aus Werten, Widersprüchen, Wahlverlierern und Wohlstandslücken. Der Manager fragt: „Wie steigern wir Effizienz?“ Der Minister müsste fragen: „Wie sichern wir Gerechtigkeit?“ Doch wer jahrelang dafür bezahlt wurde, aus Menschen Zahlen zu machen, verwechselt schnell Verantwortung mit Rentabilität. Und so wird aus jeder Gesellschaftsfrage eine Produktlinie, aus sozialer Realität ein KPI-Dashboard.
Das Ergebnis: Politik wird zur Strategie-Session, Regieren zur Marktbewertung. Bürger sind keine Aktionäre – aber unter der Hand behandelt man sie längst so. Hauptsache, die Stimmung bleibt „bullish“. Und wenn nicht? Dann wird’s eben umstrukturiert. So etwas nannte man früher Demokratiekrise. Heute heißt es: Rebranding.
Historische Blutflecken in der Bilanz
Dieses Experiment ist keine Neuheit. Die deutsche Nachkriegsgeschichte ist übersät mit politischen Exzellenzprojekten, die an der Realität der Wirtschaft gescheitert sind – und umgekehrt. Der Transfer zwischen Ministerium und Management gleicht seit Jahrzehnten einer Pendeltür, hinter der man Karriere mit Kompetenz verwechselt.
Roland Koch zum Beispiel. Vom hessischen Landesvater zum CEO von Bilfinger, dem angeblich neuen Hoffnungsträger der deutschen Bauindustrie. Was folgte: Projektabbrüche, Milliardenverluste, interne Machtkämpfe. Koch verabschiedete sich, Bilfinger implodierte. Man könnte sagen: Er brachte Bilfinger eine „stabile Führung“. Stabil im Sinne eines Betonblocks, der direkt auf den Fuß fällt.
Jürgen Rüttgers war kaum aus der Staatskanzlei verschwunden, da landete er im Aufsichtsrat bei RWE. Ein Mann mit Erfahrung in Energiefragen, klar – immerhin hatte er in NRW genug Kraftwerke politisch ab- oder eingeschaltet. RWE ging danach durch eine der größten Identitätskrisen ihrer Geschichte. Verluste, Kritik, Rücktritt. Die Parallelen zu Roland Koch sind fast poetisch: Ein Positionswechsel – und plötzlich ist Leistung nicht mehr steuerbar, sondern steuerpflichtig.
Matthias Wissmann wiederum meisterte den Spagat zwischen Verkehrsministerium und Automobilindustrie – oder sagen wir: er monetarisierte ihn. Vom politischen „Lenker“ zum Lobbyisten der Luxusklasse. Er war nie eine Katastrophe, aber das Sinnbild jener „Drehtürpolitik“, bei der Ethik das Einzige ist, was außen vor bleibt.
Die Muster gleichen sich: Wer im politischen System gelernt hat, Menschen zu vertreten, lernt im Konzern, sie zu verkaufen. Und wer glaubt, er könne zwischen diesen Welten mühelos wechseln, verliert irgendwann den Boden unter den eigenen Grundsätzen.
Der amerikanische Albtraum
Drüben über dem Atlantik ist man da schon erfahrener in Scheitern. Die USA, ewiges Labor für politische Größenwahn-Experimente, haben eine ganze Galerie gescheiterter Managerpolitiker hervorgebracht.
Rudy Giuliani – dereinst Amerikas Bürgermeister, später Anwalt, dann Reality-Zombie. Zwischen Ukraine-Geschäften, Pleiten und der bizarren Pressekonferenz mit Farbe im Gesicht hat er endgültig bewiesen, dass Macht und Kompetenz zwei verschiedene Sprachen sprechen.
Hillary Clinton, die intellektuelle Gegenthese zur Managementromantik, hat mit ihren Reden bei Goldman Sachs den Glauben an moralische Unabhängigkeit eindrucksvoll delegiert. 250.000 Dollar pro Vortrag – so klingt Transparenz in neoliberaler Tonlage. Und ihre Clinton Foundation? Ein Spendenmagnet zwischen Diplomatie und Eigenwerbung, der Kritik mit PR-Statements bekämpfte, als ginge es um Marktanteile.
Donald Trump schließlich, der CEO der Nation, hat das System ad absurdum geführt. Vorher vier Casino-Pleiten, nachher eine stürzende Aktie mit dem sprechenden Namen „Truth Social“. Er bewies, dass Unternehmertum kein Qualitätsmerkmal ist – es ist ein Marketingeffekt. Wenn Gier sich als Patriotismus verkleidet, stehen Applaus und Abgrund auf derselben Bühne.
In allen Fällen trifft das gleiche Muster: Manager in der Politik agieren, als könnten sie ein Land wie ein Unternehmen führen. Sie verhandeln Zustimmung wie Marktanteile, reden von „Wertschöpfungsketten“, wenn es um Bildung geht, und von „Synergien“, wenn sie eigentlich Privatisierungen meinen.
Managerlogik trifft Politikrealität
Das Missverständnis beginnt beim Menschenbild. In der Wirtschaft ist der Mensch Kostenstelle und Konsument zugleich. In der Demokratie ist er – theoretisch – Souverän. Doch während der Manager den Homo oeconomicus optimiert, kämpft die Politik (oder sollte kämpfen) um den Homo sapiens. Und hier scheitert das System CEO gnadenlos.
Ein Manager hat gelernt, Entscheidungen nach Zahlen zu treffen. Politik aber lebt von Ambiguität. Das eine funktioniert bei klarer Datenlage, das andere trotz Ungewissheit. Der Manager sagt: „Wir brauchen ein klares Ziel.“ Der Politiker weiß: Ein Ziel reicht nie, weil jede Entscheidung Nebenwirkungen produziert – sozial, moralisch, kulturell. Ergebnisse lassen sich nicht in Umsatz umrechnen, sondern bestenfalls in Vertrauen. Und genau das ist die Währung, die den Managern fehlt.
Merz’ Kabinett wirkt wie eine Coverband aus Karrieristen, die den Song der Verantwortung spielen, aber den Text nicht kennen. Da steht man nebeneinander, nickt kontrolliert und klatscht zu Kennzahlen, während das Land sich fragt, wer eigentlich den Takt vorgibt.
Vertrauter Boden: Lobby trifft Lobby
Steht eine weitere Frage: Sind CEOs im Ministeramt nicht zwangsläufig anfälliger für Lobbyeinflüsse – einfach, weil sie die Sprache der anderen Seite fließend sprechen? Ein ehemaliger Vorstand hat keine natürliche Distanz zur Wirtschaft, er ist die Wirtschaft. Die Aufsichtsratsetage ist für ihn kein fremder Planet, sondern ein zweites Wohnzimmer mit besserem Catering. Da findet kein Kulturschock statt, höchstens ein Wiedersehen unter Partnern.
Wer jahrzehntelang in Netzwerken agiert hat, in denen man sich mit Vornamen begrüßt und mit Beraterverträgen verabschiedet, bringt diese Sozialstruktur natürlich mit in die Politik. Lobbyismus wird dann nicht als Einfluss empfunden, sondern als Routine. Gespräche über Projekte, Beratung, Marktchancen – nur sind die „Projekte“ jetzt Gesetze, die Beratung heißt Ausschussarbeit, und die Marktchancen nennen sich „Standortpolitik“.
Das gefährliche daran: Diese Nähe muss gar nicht aus bösem Willen entstehen. Sie ergibt sich aus Identität. CEOs fühlen sich ihren ehemaligen Kollegen näher als einem Rentner mit 1.200 Euro im Monat, einfach weil sie die gleichen Konferenzen besucht, die gleichen Bücher gelesen, die gleichen Phrasen verinnerlicht haben. „Effizienzsteigerung“, „Digitalstrategie“, „Transformation“ – Vokabeln, die in Vorstandsberichten glänzen, in Parlamenten aber blenden.
Und so entsteht ein Subtext: Wenn Wirtschaftsbosse Politik betreten, betreten sie keinen neuen Raum, sondern erweitern den eigenen. Sie müssen den Lobbyismus nicht erst finden – er wartet schon mit Namensschild am Eingang. Eine Demokratie, die das zulässt, investiert am Ende nicht in Zukunft, sondern in Rückkopplung.
Narrative, die sich weigern zu sterben
Doch das Märchen lebt. Es heißt, Wirtschaftsbosse würden frischen Wind bringen, Effizienz fördern und die Verwaltung revolutionieren. „Endlich mal Macher“, ruft der Stammtisch, während der Wähler nicht merkt, dass „Macher“ auch nur Leute sind, die andere machen lassen – und die Rechnung selbst schreiben.
Das Narrativ ist so zäh, weil es tief in unserem kulturellen Selbstbild steckt. Wir bewundern die Erfolgreichen, nicht die Verständigen. Wir glauben, Geld bedeute Verstand, und Prestige ersetze Prinzipien. „Wenn er Milliarden bewegt hat, kann er auch den Haushalt führen“, heißt es. Als würde jemand, der gut grillt, automatisch die Feuerwehr leiten können.
Diese Denkfalle ist gefährlich, weil sie Demokratie in ein unternehmerisches Projekt verwandelt. Bürger werden zum Marktsegment, Parteien zu Marken, und Politiker zu Produktmanagern ihrer eigenen Popularität. Das führt zu einer Politik, die Erwartungen managt, aber keine Realität gestaltet. Eine Regierung, die über Zahlen redet, während sie Menschen verliert.
Wir lernen nichts – gar nichts
Man möchte glauben, dass Geschichte lehrt. Doch sie tut es nicht – sie wiederholt sich, nur besser designt. Deutschland hat aus Roland Koch und Co. gelernt, dass Wirtschaft und Staat zwei verschiedene Organismen sind. Dann kam Merz und meinte, man könne daraus Hybride züchten. Spoiler: Es sind Zombies geworden.
Wir wählen sie trotzdem. Weil wir hoffen, dass Geld Kompetenz beweist. Weil wir glauben, die Sprache der Bilanzen sei universell. Und weil wir uns lieber belügen lassen, als zuzugeben, dass Gemeinwohl anstrengender ist als Gewinn.
Wir fördern Manager, die Verwaltung spielen, und Politiker, die Vorstände werden – und nennen das Fortschritt. Ein teurer Euphemismus für Stillstand. Das traurige Fazit: Wir leben in einem Land, das mehr Bewerbungsfotos als Überzeugungen produziert.
Wahlrecht als Firewall?
Vielleicht ist es an der Zeit, nicht nur zu wählen, wer uns regiert, sondern auch, wer nicht. Ein demokratischer Spamfilter für Karrieristen. Ein Cooling-Off-Gesetz für Menschen mit Bonuskultur. Wer in den letzten zehn Jahren mehr an Shareholder als an Staatsbürger gedacht hat, sollte eine Pause einlegen – und zwar nicht auf Staatskosten.
Andere Länder kennen solche Mechanismen längst. In Skandinavien sind Nebentätigkeiten streng reguliert, in der Schweiz sind Interessenkonflikte öffentlich einsehbar. Nur in Deutschland vertraut man weiter auf „Anstand“ – ein Konzept, das inzwischen klingt wie ein nostalgischer Werbeslogan aus den Achtzigern.
Vielleicht liegt darin unser größter Irrtum: Wir glauben, Integrität sei eine Frage der Absicht, nicht der Struktur. Aber Systeme korrumpieren nicht Menschen – Menschen passen sich Systemen an. Deshalb müssen wir endlich Strukturen schaffen, die Macht wieder zu Verantwortung zwingen.
Aktienkurs Demokratie – Das Fazit
Der Versuch, Politik zu managen, ist die wohl teuerste Vertrauensfalle unserer Zeit. Manager sind keine besseren Minister, Minister keine besseren Manager. Das Problem liegt nicht (immer) in der Person, sondern in der Denkweise. Die Sprache der Wirtschaft ist die Syntax des Gewinns; die der Politik die Grammatik des Gemeinwohls. Beides zu vermischen, ergibt nur Kauderwelsch.
Die Demokratie ist keine Aktie. Man kann sie nicht handeln, nur halten. Und wer sie mit CEO-Charme verwaltet, sollte sich nicht wundern, wenn ihr Kurs fällt. Vielleicht braucht es keine weiteren Merz-Momente, um das zu begreifen – vielleicht nur eine Gesellschaft, die endlich versteht, dass Kompetenz nicht auf der Gehaltsabrechnung steht, sondern im Gewissen.