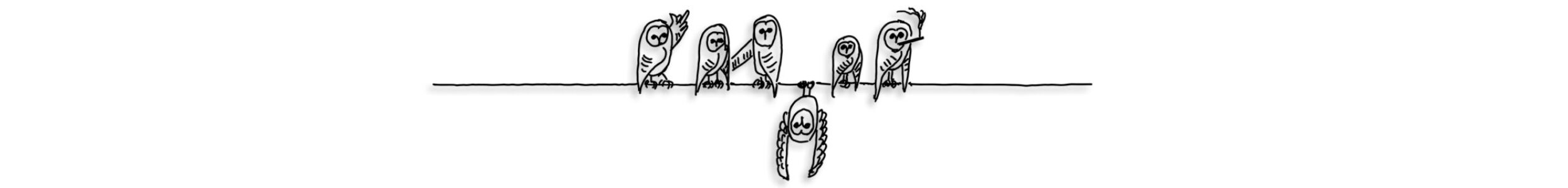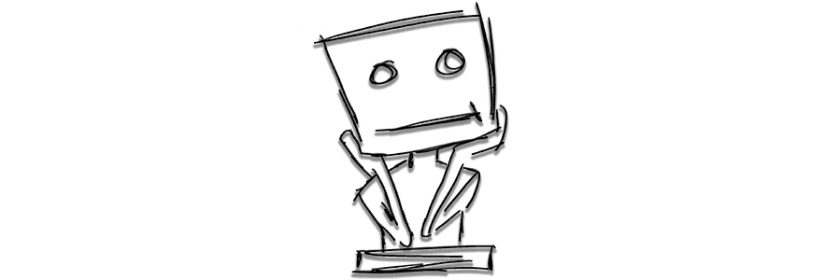Oder: Warum ich anscheinend zu wenig chaotisch bin, um neurodivers zu gelten.
Ich weiß nicht, wann genau es passiert ist – vermutlich irgendwo zwischen dem fünften viral gegangenen ADHS-Meme und der Netflix-Doku über den genialen Autisten mit Spezialinteressen in Zahlentheorie –, aber plötzlich scheint es, als gäbe es nur noch zwei Kategorien: völlig neurotypisch oder komplett drüber. Nichts dazwischen. Keine Zwischentöne, keine halben Schattierungen, nur noch Extreme. Wenn du nicht gleichzeitig Lego-Farben nach Wellenlänge sortierst und dabei deine Tränen in Taktstrukturen zählst, bist du wohl einfach „nur ein bisschen zerstreut“.
Ich sage das natürlich mit liebevollem Sarkasmus, weil dieses Phänomen mich betrifft. Ich sitze also irgendwo zwischen allen Stühlen: zu organisiert für die hyperaktive Chaosfraktion, zu unauffällig für die Social-Media-Algorithmen, zu unaufgeregt, um als „Beispiel für gelebte Neurodiversität“ eingeladen zu werden. Aber auch zu erschöpft, um so zu tun, als wäre meine Energie unbegrenzt und mein Gehirn ein reibungsloser Motor. Kurzum: durchschnittlich betroffen, aber vollzeit beschäftigt mit der Instandhaltung des eigenen Funktionierens.
Die Logik des Sichtbaren
Das Problem fängt schon bei der Sichtbarkeit an. Wir leben in einer Kultur, in der nur das gilt, was man bildlich darstellen kann. Extreme verkaufen sich gut – sowohl in Schlagzeilen als auch in Emotionen. Wer „funktioniert“, fliegt unter dem Radar. Das sorgt für eine paradoxe Situation: Je besser du dich anpasst (Masking), desto unsichtbarer wirst du. Je stärker du maskierst, desto weniger glaubt man dir, dass du überhaupt etwas maskieren musst. Eine Art sozialer Einstein’scher Effekt – nur dass du statt Raum und Zeit Aufmerksamkeit und Zweifel krümmst.
Auf TikTok, Instagram und YouTube sehe ich endlos Content mit Titeln wie „10 sichere Anzeichen, dass du ADHS hast!“ oder „So erkennst du Autismus bei Erwachsenen!“. Als Clickbait funktioniert das hervorragend. Nur – wenn du dann sagst: „Ja, bei mir ist das ähnlich, aber weniger extrem“, bekommst du diesen skeptischen Blick, irgendwo zwischen Mitleid und Misstrauen. Es ist, als wolle die Außenwelt ein Vorzeigebeispiel, kein unscharfes Porträt. Wenn es nicht krass ist, zählt es nicht.
„Hast du das auch?“ – Das neurodiverse Kreuzverhör
Ich nenne es das „ADHS-Quiz des Alltags“. Es fängt harmlos an: Jemand erfährt, dass du diagnostiziert bist, und schon geht’s los. „Hast du auch diese eine Sache mit den Schlüsseln?“ – „Wie ist das bei dir mit Multitasking?“ – „Wie ist das bei dir mit Terminen und Pünktlichkeit?“ – „Ich hab gelesen, dass ihr alle hyperfokussiert seid, stimmt das?“ Ich fühle mich dann kurz wie ein Tier im Zoo, das auf Zuruf die Symptome vorführen soll. Wenn ich ehrlich antworte („Manchmal, je nach Tag und Kontext“), folgt gerne das enttäuschte Nicken – als hätte ich die falsche Antwort gegeben.
Das Problem mit dieser Haltung ist nicht die Neugier selbst, sondern die Logik dahinter. Sie geht davon aus, dass man Neurodiversität erkennen muss. Dass sie sich zeigen, dramatisieren, beweisen lassen müsse. Dabei liegt die Wahrheit oft in den Mikroebenen – in der mentalen Erschöpfung nach Smalltalk, im endlosen Gedankenkarussell bei einfachsten Entscheidungen, in der Energie, die man investiert, um im Supermarkt nicht zwischen zwei Regalreihen stecken zu bleiben, weil die Musik gerade zu laut ist. Das sieht keiner. Und gerade darum glauben viele, da sei auch nichts.
Wenn Normalität das ultimative Alibi wird
„Aber du wirkst gar nicht so.“ – Dieser Satz ist der Endgegner. Er klingt nach Kompliment, ist aber in Wirklichkeit das rhetorische Äquivalent zu einem Tritt ins eigene Selbstverständnis. Denn was heißt das? Dass ich mich gut verstelle? Dass ich mich bemühe, normal zu klingen, normal zu wirken, normal zu leben? Bingo. Ich kann gerade noch genug kompensieren, um durchs Raster der „Auffälligkeit“ zu fallen – und genau das wird dann als Beweis meiner Unbetroffenheit verwendet. Perfekte Ironie: Je besser ich mich in die Norm presse (siehe Masking), desto weniger existiert mein Anderssein für andere.
Dass es im Hintergrund Energie kostet, scheint schwer vermittelbar. Diese unsichtbare Mühe bleibt unbewertet, weil sie eben nicht sichtbar, messbar, „instagrammable“ ist. Aber sie ist da. Sie ist die ständige Selbstkontrolle, das manuelle Nachjustieren, der Versuch, keine soziale Regel zu verpassen, während andere frei improvisieren. Sie ist das mentale Multitasking zwischen Konzentration, Reizfilterung und emotionaler Regulierung. Und doch höre ich regelmäßig: „Aber du bist doch ganz normal.“
Gaslighting in gesellschaftlich akzeptabler Verpackung
Das wirklich Heimtückische ist, dass dieses Muster von Zweifeln und Nachfragen oft gar nicht böse gemeint ist. Es ist subtiler – und deshalb gefährlicher. Gaslighting in der Light-Version: Nur ein Hauch von Zweifel, fein verpackt in freundliches Interesse. „Bist du sicher, dass du das hast?“ oder „Vielleicht ist das einfach Stress?“ oder mein persönlicher Favorit: „Ich hab auch manchmal Konzentrationsprobleme, vielleicht bist du einfach nur müde.“
Diese Art des Gaslightings ist perfide, weil sie Rationalität vorgibt, aber eine fundamentale Erfahrung entwertet. Sie stellt nicht nur das Wie in Frage, sondern das Ob. Und wie wehrt man sich dagegen? Man will ja nicht aggressiv klingen, nicht missionieren oder Mitleid einfordern. Also schweigt man. Maskiert ein bisschen mehr. Lächelt ein bisschen länger. Bis irgendwann keiner merkt, dass man überhaupt noch spielt.
Masking: Der unsichtbare Vollzeitjob
Maskieren heißt nicht, sich zu verstellen, um zu täuschen – es heißt, sich anzupassen, um zu überleben. Es ist das dauerhafte Übersetzen der eigenen Funktionsweise in eine Sprache, die gesellschaftlich lesbar ist. Und das ist Energiearbeit. Während andere morgens einfach aufstehen, jongliere ich bereits beim Frühstück mit Konzentration, Struktur, Emotion und Stimulusmanagement. Ich denke in Zwischenräumen. Ich existiere in Steuerungsmodi.
Masking ist in gewissem Sinne wie ein unsichtbarer zweiter Betriebssystem-Prozess. Einer, der ständig im Hintergrund läuft, damit der sichtbare Teil reibungslos erscheint. Nur dass es keine automatische Update-Funktion gibt. Und irgendwann, wenn der Tag vorbei ist, wenn das Licht ausgeht, dann kommt der Bluescreen: Erschöpfung, Selbstzweifel, mentale Leere. Kein Drama, keine Panik – einfach ein geistiger Systemcrash, weil der Speicher mal wieder voll war.
Das Zuviel und das Zuwenig gleichzeitig
Das Komische an Neurodiversität ist: Man ist oft beides zugleich – zu viel und zu wenig. Zu sensibel, zu direkt, zu still, zu laut, zu strukturiert, zu verplant. Es gibt kein richtiges Maß. Die Gesellschaft erwartet Balance, während das eigene Nervensystem ein Sinfonieorchester mit freilaufenden Schlagzeugern ist. Ich bestehe auf das Recht, widersprüchlich zu sein. Sich selbst nicht ganz zu verstehen, aber trotzdem nicht falsch zu sein.
Und genau hier liegt der Tiefpunkt dieser popkulturellen Darstellung von Neurodiversität: Sie entmenschlicht. Sie reduziert auf Symptome, statt zu zeigen, wie komplex und vielschichtig Alltagsnavigation sein kann. Neurodiversität ist kein cooles Branding, kein Hashtag für Selbstinszenierung. Sie ist das Ringen mit der eigenen Wahrnehmung, während man versucht, nicht jeden Moment in Metaebenen zu zergliedern.
Die Mittleren als blinde Flecken
In der Wahrnehmung gibt es die laut Auffälligen und die still Unsichtbaren. Dazwischen – nichts. Dabei sind genau diese „mittleren Fälle“ der Schlüssel zum Verständnis. Sie zeigen, dass neurodiverse Menschen nicht in zwei Schubladen passen: auffällig oder gesund. Sie illustrieren die Bandbreite, die das menschliche Gehirn hat, ohne Pathos und Pathologie. Diese Geschichten fehlen. Sie sind zu unspektakulär, zu unfilmisch. Kein Kinostoff, aber Lebensalltag.
Ich glaube, die Aufklärung über Neurodiversität scheitert nicht an mangelnder Information, sondern an Erzählstrukturen. Wir verstehen nur Extreme, weil sie Dramaturgie bieten. Das Mittelmaß hat keine narrative Spannung. Und doch steckt in diesen Zwischenräumen die meiste Wahrheit. Die alltägliche, unheroische Anstrengung, halbwegs mitzuhalten, ohne ständig erklären zu müssen, warum alles etwas mehr Energie braucht.
Hinsehen statt Vorstellen
Wenn man also eines ändern wollte, dann vielleicht das: weniger Projektionen, mehr Wahrnehmung. Nicht die Frage „Wie schlimm ist es?“, sondern: „Wie zeigt es sich bei dir?“ Keine Beweisführung, sondern Verständnis. Denn nur weil man’s nicht erkennt, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Das Unsichtbare hat Gewicht – man sieht’s nur erst, wenn man aufhört, die Extreme zu glorifizieren.
Ich weiß nicht, ob es Mut oder Müdigkeit ist, immer wieder dieselben Dinge zu erklären. Vielleicht eine seltsame Mischung aus beidem. Aber ich werde wohl weiter schreiben, bis irgendwer versteht: Ich bin nicht der Durchschnitt, den ihr ignoriert. Ich bin die Ausnahme, die ihr nicht erkennt. Und das reicht mir.