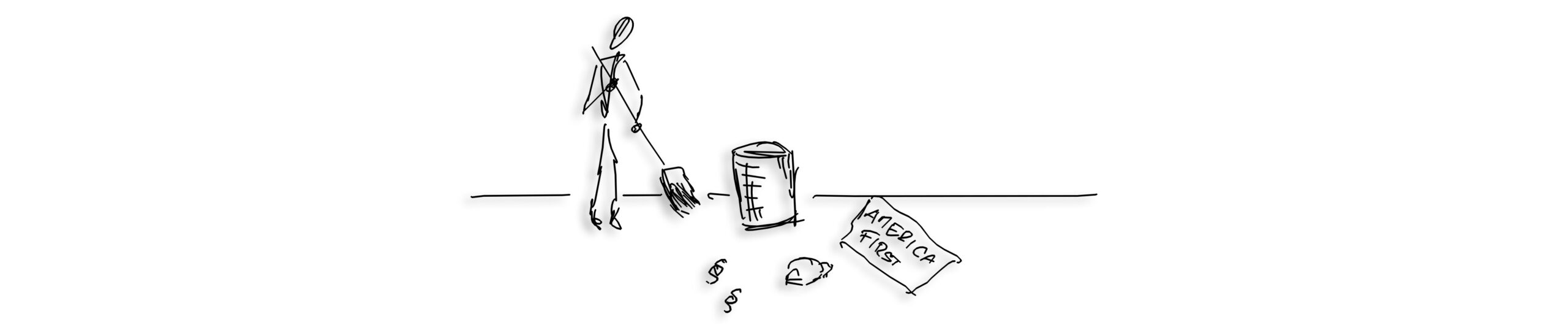Eigentlich ist es noch zu früh, um darüber nachzudenken, den Post-Trumpismus. Eigentlich. Und doch bleibt mir keine Wahl, denn das Gespenst, das durch Amerika und die Welt geistert, lässt sich nicht einfach ausblenden.
Die Vorstellung einer Zeit nach Trumpismus erscheint so fern, dass sie fast wie eine Utopie wirkt. Was bleibt, wenn die Trümmer von „America First“ weggeräumt sind? Und wer räumt sie auf?
Aufräumen? Aber wie?
Reset-Button drücken? Schöne Idee, aber wo ist er? In den Dekreten? Den hätte ein Nachfolger mit ein paar Federstrichen zumindest administrativ neutralisieren können. In den Verträgen?
Da wird es komplizierter, denn internationale Vereinbarungen sind nicht einfach eine Excel-Liste, die sich per Mausklick löschen lässt. In den Methoden? Da steckt der wahre Teufel. Die systematische Lüge, die Eskalation als politisches Instrument, die absolute Wahrheitsverweigerung – all das ist nicht einfach eine Regel, die man zurücknehmen kann.
Das ist eine Kultur. Eine, die bleibt. Und die über Jahre gewachsen ist, sich tief in die Mechanismen des Staates gefressen hat. Es geht nicht nur um Gesetze oder Vorschriften, sondern um eine Denkweise, die sich in Verwaltungen, Medien und selbst in der Gesellschaft verankert hat.
Wie begegnet man einer Ideologie, die nicht als einzelne Partei oder politische Richtung existiert, sondern als Lebensgefühl? Als Weltbild? Die sich nicht auflöst, nur weil ein neuer Präsident ins Amt kommt?
Konsequenzen? Oder doch nicht?
Juristisch betrachtet müsste es Konsequenzen geben. Für Trump selbst, für seine Anhänger, für die Mitläufer, die sich unter dem Deckmantel des Chaos im Recht wähnten.
Aber da fangen die Probleme erst an. Denn wie geht man mit Millionen von Menschen um, die nicht einfach politischer Gegner, sondern glühende Jünger sind? Mit Staatsanwälten, die den Rechtsstaat als Werkzeug zur Machtsicherung missbrauchen? Mit Richtern, die sich an diese Realität angepasst haben?
Das Rechtssystem auf Recht zurückstellen, ja. Aber was, wenn es sich gar nicht mehr zurückstellen lässt? Was, wenn der Gedanke, dass Recht beliebig interpretierbar ist, zu tief in das juristische System eingedrungen ist? Was passiert mit den Hunderten von Richtern und Beamten, die von Trump ernannt wurden? Was mit den Sicherheitsbehörden, die unter seiner Regierung politisiert wurden?
Und dann ist da noch die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Trumpismus hat sich nicht nur über Politik, sondern über tief verwurzelte Ressentiments verbreitet. Über das Gefühl, dass „die da oben“ gegen „uns hier unten“ arbeiten. Kann man eine juristische Aufarbeitung betreiben, ohne eine gesellschaftliche Explosion zu riskieren?
Faktor Geld & Macht
Kapital und Macht sind untrennbar miteinander verknüpft. Die USA sind längst eine Oligarchie, in der finanzielle Interessen Politik bestimmen. Wer Einfluss will, muss Geld haben – und umgekehrt.
Die wirtschaftliche Macht von Konzernen hat sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter verfestigt. Wie kann man dieses Ungleichgewicht wieder aufbrechen? Braucht es radikale Reformen im Lobbyismus? Oder ist der Einfluss des Geldes auf die Politik unumkehrbar geworden?
Entdemokratisierung durch Kapital
Das politische System wird zunehmend von wirtschaftlichen Interessen dominiert. Unternehmen wie Google, Facebook und Amazon kontrollieren nicht nur Märkte, sondern auch Informationen. Ihre Algorithmen bestimmen, was Millionen Menschen sehen, lesen und denken.
Die Macht dieser Tech-Giganten übertrifft die vieler Nationalstaaten. Wie lässt sich verhindern, dass Demokratie zu einer bloßen Fassade verkommt? Welche Regulierungen sind notwendig, um den Einfluss des Kapitals zu begrenzen, ohne Innovation zu ersticken?
Horizontale Kartelle
Elon Musk ist ein Paradebeispiel für die Konzentration wirtschaftlicher und medialer Macht in den Händen weniger. Mit Tesla, SpaceX und Twitter kontrolliert er Schlüsselbereiche der Infrastruktur, von Transport über Raumfahrt bis zur digitalen Kommunikation.
Ist es gesund für eine Demokratie, wenn Einzelpersonen solch massive Kontrolle ausüben können? Müssen wir die Mechanismen zur Zerschlagung monopolartiger Strukturen verschärfen? Oder bewegen wir uns auf eine Zukunft zu, in der Konzerne die eigentlichen Staaten sind?
Menschen und ihre Wahrheit
Ein Land, in dem Millionen glauben, dass die Wahrheit verhandelbar ist, ist ein Land, das nicht mehr argumentiert, sondern nur noch glaubt.
Fakten existieren in einer Parallelwelt, in der sie bestenfalls als „alternative Wahrheit“ eine Erwähnung finden. Wie bringt man Fakten in Köpfe, ohne sie vorher ein- oder abzuschlagen? Wie überzeugt man Menschen davon, dass ihre Wut auf falschen Annahmen basiert, wenn ihre Identität davon abhängt, dass genau diese Annahmen wahr sind?
Die USA sind nicht nur ein gespaltenes Land. Sie sind zwei Realitäten, die nicht mehr miteinander sprechen können. Und genau das ist der eigentliche Schaden, den Trump hinterlässt: Die Unmöglichkeit, überhaupt wieder einen gemeinsamen Boden zu finden.
Diese Situation verschärft sich durch soziale Medien, durch Nachrichtensender, die nur noch bestätigen, was das Publikum hören will. Wie können Medien wieder zu einer Instanz werden, die Vertrauen schafft, anstatt Meinung zu verkaufen?
Umbau oder Untergang?
Bleibt die Frage: Muss das politische System umgebaut werden? Wahlen, die in Chaos enden. Abgeordnete, die Angst haben, das Wahlergebnis anzuerkennen. Ein Zweiparteiensystem, das in einem Belagerungszustand gefangen ist. Ist das noch Demokratie oder nur noch ein Gladiatorenkampf, der in der Arena von Fox News und CNN ausgetragen wird?
Die internationale Perspektive ist nicht weniger bedrückend. Wie kann der Trumpismus geächtet werden, ohne ihn zur ewigen Märtyrer-Idee zu machen? Wie verhindert man, dass andere Länder sich von diesem Modell inspirieren lassen? Denn das tun sie.
Merz und Co. lächeln zu freundlich in die Kamera, wenn sie von „Lehren aus Amerika“ sprechen. Die toxische Mischung aus Populismus, Realitätsverweigerung und destruktiver Machtpolitik hat ihre Spuren in Europa hinterlassen.
Und hier?
Die entscheidende Frage ist also nicht nur, was in den USA passieren muss, sondern was bei uns geschehen sollte. Wie befreien wir uns von dem Geist, der auch in Deutschland und Europa Menschen einfängt? Der die Gesellschaft in „die Guten“ und „die Anderen“ aufspaltet? Wie verhindert man, dass sich die politische Kultur dauerhaft verändert, wenn Teile der Opposition bereits eifrig daran arbeiten, genau das zu tun?