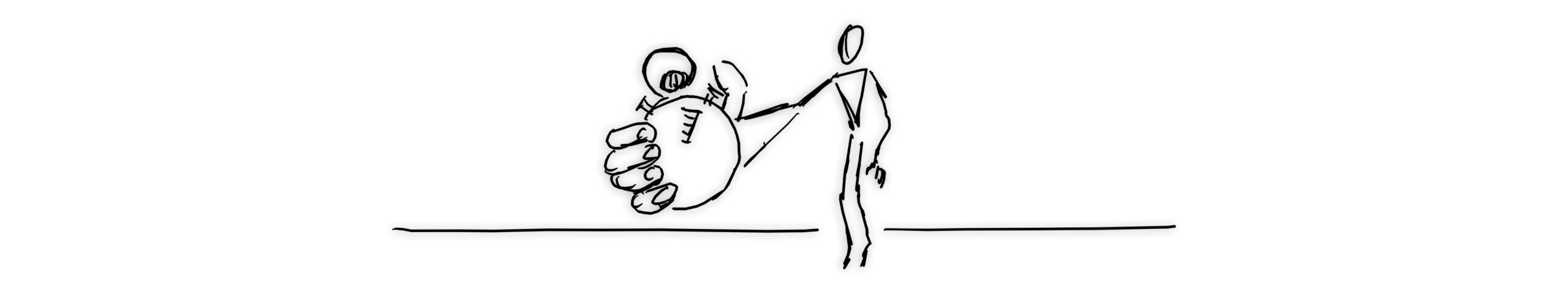Immer schneller, immer mehr, immer gehetzter. So sieht der Alltag vieler Menschen aus. Der Podcast „Radiowissen“ hat mit seiner Episode Tempo – Immer schneller, immer mehr ein Thema angesprochen, das mich nicht mehr loslässt. Sind wir in einem System gefangen, das uns beschleunigt, bis wir uns selbst verlieren? Ist das Leben unter ständiger Volllast wirklich alternativlos? Oder sollten wir beginnen, unsere eigene Zeit zurückzufordern?
Multitasking als Lebensprinzip – oder als Illusion?
Es beginnt schon morgens: Beim Frühstück noch schnell die Mails checken, auf dem Weg zur Arbeit einen Podcast hören, in der Mittagspause private Nachrichten beantworten. Wir jonglieren mit unseren Aufgaben und sind doch nie wirklich bei der Sache. Der Soziologe Hartmut Rosa spricht von sozialer Beschleunigung – alles um uns herum wird schneller, und wir passen uns an, oft ohne es bewusst zu merken. Doch ist Multitasking wirklich eine Lösung?
Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass unser Gehirn nicht für echtes Multitasking gemacht ist. Was wir stattdessen tun, ist „Task-Switching“ – wir springen von einer Aufgabe zur nächsten und verbrauchen dabei mehr mentale Energie, als wenn wir eine Sache nach der anderen erledigen würden. Das führt nicht nur zu schnellerer Erschöpfung, sondern auch zu einer schlechteren Qualität unserer Arbeit. Doch die moderne Arbeitswelt verlangt von uns, immer effizienter zu sein.
Wer profitiert von unserer Hetze?
Die Wirtschaft ist auf Effizienz getrimmt. Jedes Jahr müssen wir mehr leisten – aber nicht für uns selbst. Unternehmen optimieren Prozesse, setzen uns unter Druck und belohnen diejenigen, die „Leistung zeigen“. Doch wer zahlt den Preis? Die psychischen Opportunitätskosten sind hoch: Burnout, Stress, das Gefühl, dass wir unser eigenes Leben verpassen.
Die berühmte Studie von Robert Levine hat bereits in den 1990er Jahren gezeigt, dass das Lebenstempo in Städten mit steigendem Wohlstand zunimmt. Länder wie Deutschland, die Schweiz oder Japan gehören zu den schnellsten Gesellschaften der Welt. Die Konsequenz? Ein ständiger Druck, mitzuhalten, sich anzupassen, nicht zurückzufallen.
Innovation braucht Zeit – doch Zeit ist ein Luxusgut
Wann haben wir das letzte Mal nichts getan? Kein Scrollen, kein Hörbuch, kein Podcast. Einfach nur da sitzen und nachdenken. Zeit für Reflexion ist der Nährboden für echte Innovation. Doch stattdessen hetzen wir von Aufgabe zu Aufgabe, in der Hoffnung, irgendwann einmal „fertig“ zu sein. Aber wann ist dieser Zeitpunkt erreicht?
In der Geschichte war es oft die Muße, die den größten Ideen Raum gegeben hat. Große Denker wie Newton oder Einstein kamen nicht durch durchgetaktete Meetings zu ihren bahnbrechenden Erkenntnissen, sondern durch Zeiten des Nachdenkens, der Kontemplation. Heute jedoch haben wir selbst in unseren Pausen keine Ruhe mehr – sie sind durchzogen von Ablenkungen und Mikro-Stressfaktoren.
Wann sagen wir „Genug“?
Arbeiter haben in der Vergangenheit für kürzere Arbeitszeiten und faire Bedingungen gekämpft. Heute müssen wir überlegen, wie wir unsere eigene Lebenszeit zurückfordern. Die 4-Tage-Woche, das Recht auf Nichterreichbarkeit – all das sind Schritte in die richtige Richtung. Doch der wichtigste Schritt ist vielleicht der, den wir selbst gehen: bewusst Pausen setzen, Geschwindigkeit herausnehmen und uns erlauben, nicht immer produktiv zu sein.
Denn wenn wir unsere Zeit nicht schützen, wird sie uns genommen.
Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir nicht nur von Unternehmen fordern, unsere Lebenszeit zu respektieren, sondern auch von uns selbst, sie wieder wertzuschätzen.