Wenn ich als Ingenieur über Schamanismus nachdenke, dann scheint das auf den ersten Blick ein ziemlicher Gegensatz zu sein. Das eine ist ein jahrhundertealtes spirituelles Konzept, das in vielen Kulturen der Welt vorkommt, das andere basiert auf exakten Naturwissenschaften, Mathematik und Technologie.
Doch je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr erkenne ich Parallelen – und das wirft die Frage auf: Sind Schamanismus und Ingenieurswesen wirklich so verschieden? Oder ergänzen sie sich vielleicht sogar?
Was ist Schamanismus?
Schamanismus ist eine der ältesten spirituellen Praktiken der Menschheit. Ein Schamane oder eine Schamanin gilt als Mittler zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt.
Oft wird dieser Zugang durch Rituale, Trancezustände oder pflanzliche Substanzen ermöglicht. Ziel ist es, Heilung, Einsicht oder Balance zu bringen – für Individuen, aber auch für ganze Gemeinschaften.
In Europa kennen wir vor allem keltische Druiden oder sibirische Schamanen, während in Südamerika der Schamanismus stark mit den indigenen Kulturen des Amazonas und den Andenvölkern verbunden ist. Besonders in Südamerika spielen pflanzliche Substanzen wie Ayahuasca eine zentrale Rolle, während europäische Traditionen eher über Rituale, Meditation und Naturbeobachtung arbeiten.
Trotz unterschiedlicher Methoden geht es überall um ein tiefes Verständnis von Mensch, Natur und Energieflüssen.
Was kann ein Ingenieur aus dem Schamanismus lernen?
Als Ingenieur bin ich es gewohnt, mit klaren Strukturen zu arbeiten. Naturgesetze, Formeln und Berechnungen bestimmen meine Arbeit.
Doch wenn ich den Schamanismus betrachte, erkenne ich einen faszinierenden Ansatz: Er betrachtet Systeme als Ganzes. Ein Schamane würde nie nur ein einzelnes Symptom behandeln, sondern immer das gesamte System analysieren – das Individuum, die Umgebung, die spirituelle Dimension.
Ein zentrales Konzept im Schamanismus ist die Vorstellung von Energieflüssen und unsichtbaren Pfaden, die alles Leben miteinander verbinden.
Interessanterweise existiert ein ähnliches Konzept auch im Ingenieurswesen: Die Daten- und Energieflüsse, die in technischen Systemen eine zentrale Rolle spielen, sind ebenfalls unsichtbar und nur für „Eingeweihte“ – also Fachleute – verständlich.
Während ein Schamane die energetischen Verbindungen eines Menschen oder eines Ortes erkennt, analysiert ein Ingenieur die virtuellen Ströme von Daten und Energie in technischen Netzwerken.
Genau das fehlt oft in der modernen Technik: Wir zerlegen Probleme in Einzelteile, optimieren lokal, aber vergessen manchmal das große Ganze. Ingenieure sprechen heute von „Systems Thinking“ – eine Denkweise, die in gewisser Weise schamanischen Konzepten ähnelt.
Auch das Konzept der Intuition ist spannend. Schamanen treffen ihre Entscheidungen nicht nur auf Basis harter Daten, sondern auch durch Erfahrung, Beobachtung und innere Eingebung. In der Technik nennen wir das „Engineering Judgement“ – eine Art Bauchgefühl, das sich durch jahrelange Erfahrung entwickelt.
Naturwissenschaften und Naturheilkunde – Wie weit auseinander?
Die westliche Wissenschaft hat sich lange von traditionellen Heilmethoden abgegrenzt. Schamanische Praktiken wurden als „Aberglaube“ abgetan. Doch mittlerweile gibt es eine Annäherung: Pflanzliche Heilmittel, Meditation, Rituale – vieles davon wird wissenschaftlich untersucht und bestätigt.
Ein schönes Beispiel ist die Wirkung von Ayahuasca auf das Gehirn. Neurowissenschaftler haben gezeigt, dass die enthaltenen Stoffe tatsächlich tiefgreifende Veränderungen in der Wahrnehmung hervorrufen und sogar therapeutisch genutzt werden können. Was jahrhundertelang als „Schamanenwissen“ galt, wird nun mit modernster Technik untersucht.
Und auch in der Technik gibt es eine Parallele: Die Quantenphysik mit ihren bizarren Phänomenen erinnert manchmal an schamanische Vorstellungen von Energie und Verbundenheit. Während klassische Physik klar deterministisch ist, zeigt die Quantenmechanik, dass Realität nicht so eindeutig ist, wie wir dachten.
Analogien in Methodik und Zielsetzung: Mehr Empirie als erwartet
Ein Aspekt, der oft übersehen wird, ist die empirische Basis vieler schamanischer Praktiken. Während Schamanismus auf den ersten Blick als rein spirituell oder intuitiv erscheint, enthalten viele seiner Methoden Elemente, die mit wissenschaftlichen Langzeitstudien vergleichbar sind.
In traditionellen Gemeinschaften wurden Rituale, Heilmethoden und pflanzliche Substanzen über Jahrhunderte hinweg beobachtet und optimiert. Diese „Langzeitstudien“ basieren auf generationsübergreifender Erfahrung und systematischer Beobachtung von Ursache und Wirkung.
Ein Beispiel dafür ist der Einsatz von Ayahuasca in südamerikanischen Kulturen. Die Wirkung dieser Substanz wurde nicht nur durch subjektive Erfahrungen bewertet, sondern auch durch wiederholte Anwendung in verschiedenen Kontexten überprüft. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bilden eine Art empirisches Wissen, das sich mit moderner Wissenschaft vergleichen lässt.
Ähnlich wie Ingenieure Systeme testen und optimieren, haben Schamanen ihre Praktiken durch kontinuierliche Anpassung verfeinert.
Diese Parallelen zeigen, dass Schamanismus nicht nur auf Glauben beruht, sondern auch auf einer Form von „evidenzbasierter Praxis“, die durch Beobachtung und Erfahrung gestützt wird.
Vielleicht gar kein Widerspruch?
Je länger ich mich mit Schamanismus beschäftige, desto mehr erkenne ich, dass er kein Gegensatz zur Wissenschaft ist, sondern eine andere Perspektive auf dieselbe Realität. Beide suchen nach Mustern, nach tieferem Verständnis der Welt. Während die Wissenschaft nach Beweisen strebt, setzt der Schamanismus auf Erfahrung und Wahrnehmung.
Für mich als Ingenieur bedeutet das: Vielleicht sollten wir manchmal weniger an strikten Formeln kleben und uns mehr auf das große Ganze konzentrieren. Technik und Natur, Wissenschaft und Spiritualität – das eine muss das andere nicht ausschließen.
Vielleicht ist die Wahrheit nicht entweder-oder, sondern sowohl-als-auch.
Ich hatte bereits die Gelegenheit, mit einem südamerikanischen Schamanen in Kontakt zu treten. Leider reichte die Zeit nicht aus, um all die spannenden Themen und Konzepte, die er angesprochen hat, tiefer zu diskutieren. Doch schon dieser kurze Austausch hat mir wertvolle Einblicke gegeben und meine Sicht auf viele Dinge verändert.
Und um ehrlich zu sein, ein bisschen fühle ich mich gerade in meiner Position als Consultant als „Digitaler Schamane“.
Ich selbst begegne der Welt mit einer Mischung aus analytischer Neugier und tiefem Staunen. Immer wieder stoße ich auf Muster, die ich nicht erklären kann, die aber zu regelmäßig auftreten, um sie als Zufall abzutun. Ob in der Natur, in technischen Systemen oder im menschlichen Zusammenleben – überall gibt es verborgene Ordnungen, die unser begrenztes Verständnis herausfordern.
Die Vorstellung, dass der Mensch die Natur vollständig durchschauen könnte, halte ich für anmaßend. Wir mögen einzelne Mechanismen entschlüsseln, doch das große Ganze bleibt ein Geflecht aus Zusammenhängen, das sich unserer vollständigen Kontrolle entzieht. Für mich ist Schamanismus keine esoterische Praxis, sondern eine Haltung: die Fähigkeit, Verbindungen zu sehen, ohne sie sofort erklären zu müssen; die Demut, sich einem System anzupassen, statt es beherrschen zu wollen. Letztlich geht es darum, nicht nur Wissen anzuhäufen, sondern mit offenen Augen in einer Welt voller komplexer Muster zu leben.

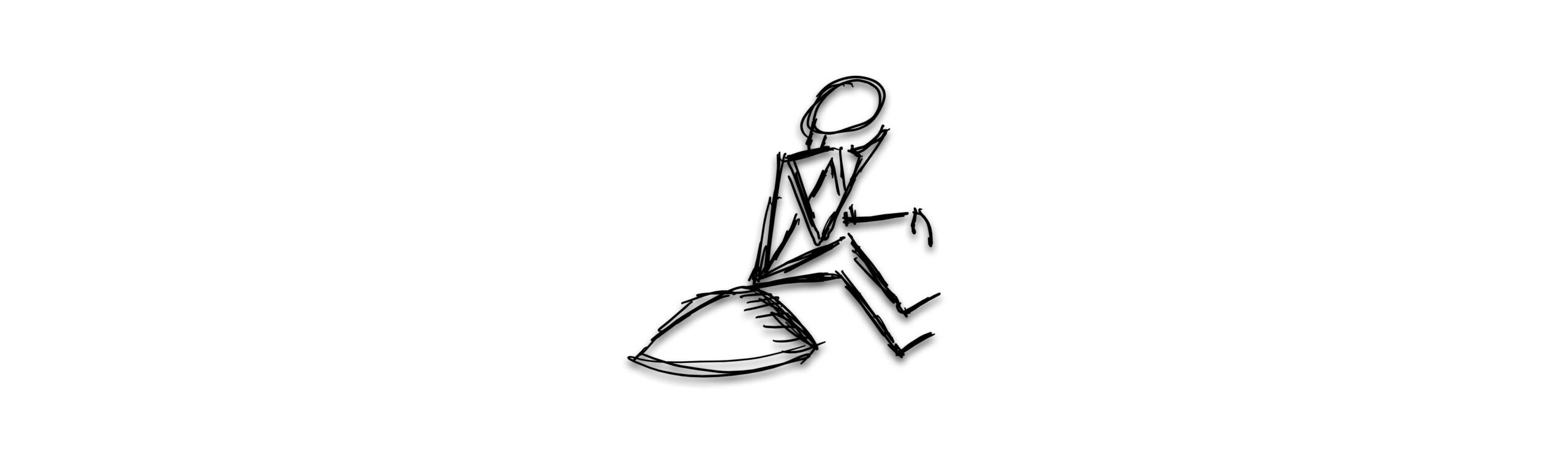
Die dünkelhafte Abgrenzung der akademistischen (Natur)Wissenschaften von den spiritistischen Wissenschaften respektive von Glaube und Religion hat sicherlich auch mit alten Wunden aus inquisitorischen Zeiten und den mannigfaltigen und zahllosen Indignationen zu tun, wovon bspw. die Demütigungen eines Galileo Galilei nur Teil der prominenten Spitze eines gewaltigen Eisbergs sind – und ich würde soweit gehen zu behaupten, dass das vorläufig (will sagen, bis weit ans Ende des letzten Jahrtausends) endgültige ideelle sowohl als auch interdisziplinär praktische Schisma, welches im Laufe des ausgehenden 18. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts vonstatten gebracht ward, letztlich durch so berühmte wiewohl – ich möchte mal mit Verlaub so sagen – letztlich nicht so sehr verständige, oder vielleicht trefflicher noch zu pointieren (nicht ganz unberechtigt) unversöhnliche philosophische sowie literarische Speerspitzen des Hochkulturbetriebs – gleichsam Evokatoren einer zukünftigen Technokratie – „verbrochen“ wurde, die u.a. durch so illustre intellektuelle Herrschaften namens Kant oder Voltaire wohlfeil repräsentiert werden …
Dass aber – von der heiligen aber neurotisch zu gerne gestrigen Mutter Kirche einmal zu schweigen – die angeblich antagonistische Seite, die ebenfalls nicht minder reich und mit allenthalb ruhmreichen wiewohl bis in unsere Gezeiten prominenten Speerspitzen vor Zeitaltern schon und noch immer (oder womöglich gerade jetzt) repräsentiert war und ist, geruht in der weitreichenden und -tragenden Frage rund um die etwaigen Ambiguitäten von Wissenschaft und Spiritualität seit jeher – und gerade in der heutigen, weil wie nie zuvor so libertären (oder libertinösen?) Zeit – eine vollkommen andere, ganzheitlich inklusionistische Einstellung zu pflegen, die trotz all der Schmach, den unzähligen Blessuren und zu allen Zeiten dramatischen kapazitären Verlusten voll trotzendem Langmut ihre Arme geöffnet zu haben und zu halten beliebt und nur zu bereit ist, den schändlichen Bruder KAIN zu empfangen, um endlich der widernatürlichen Separation das bitter nötige ein Ende zu bereiten und um durch verzeihende und wieder lieben wollende neuerliche Synthese die Renaissance eines ganzheitlichen, aufeinander rekurrierenden Wissenschaftskonglomerats einläuten und wieder errichten zu können…
Dass hierbei eine von der anderen Seite – recht eigentlich (aber auch das wird einseitig nach wie vor und wo immer heutzutage noch irgend für „plausibel“ zu postulieren möglich weiterhin hartnäckig dementiert) ein- und derselben Münze! nichts wissen will, hat quintessentiell doch nur den einen – gleichwohl so gravierenden wie -ach! so schnöden und letztlich redikulösen – Grund:
Dieser nämlich lässt sich nach meinem Verständnis und Dafürhalten komprimiert zusammenfassen in der Feststellung einer so zählebig nachhaltigen wie jeweils grundständig diametral von einander ausdifferenzierten und längstfristig tradierten – fachschaftlichen Terminologie!
Die akademisch alimentierte schulweisheitliche Alt-Herren-Eintracht in ihrem unwürdigen Dünkel einer längst schon _untoten_ Raison d‘Être, in jener Arroganz und Überheblichkeit, welches aus entsprechender Sicht noch nie wirklich ernstzunehmend gerechtfertigt werden konnte, geht sogar noch immer – oder vielleicht im Fehlverständnis der Bedeutung ihrer erfolgreich stetig fortschreitenden Forschung und der regelmäßig neuen Entdeckungen und Erkenntnisse – so weit, die fragwürdige Abgrenzung zur Welt von „Aberglaube“ und _alternativer_ Methodik künstlich am Leben und aufrecht zu halten – sei es auch mit so unziemlichen Mitteln wie referenzieller Diffamierung, wovon sicherlich die Bezeichnung des jüngst nachgewiesenen Hicks-Bozons als „Gottesteilchen“ gewiss die populärste und impaktibelste ist.
So – nu‘ hab‘ ick erstma‘ fertich!
-tata S
„Komm, wir gehen in den Birkenwald!-
Ich glaub, die Pillen wirken bald.“