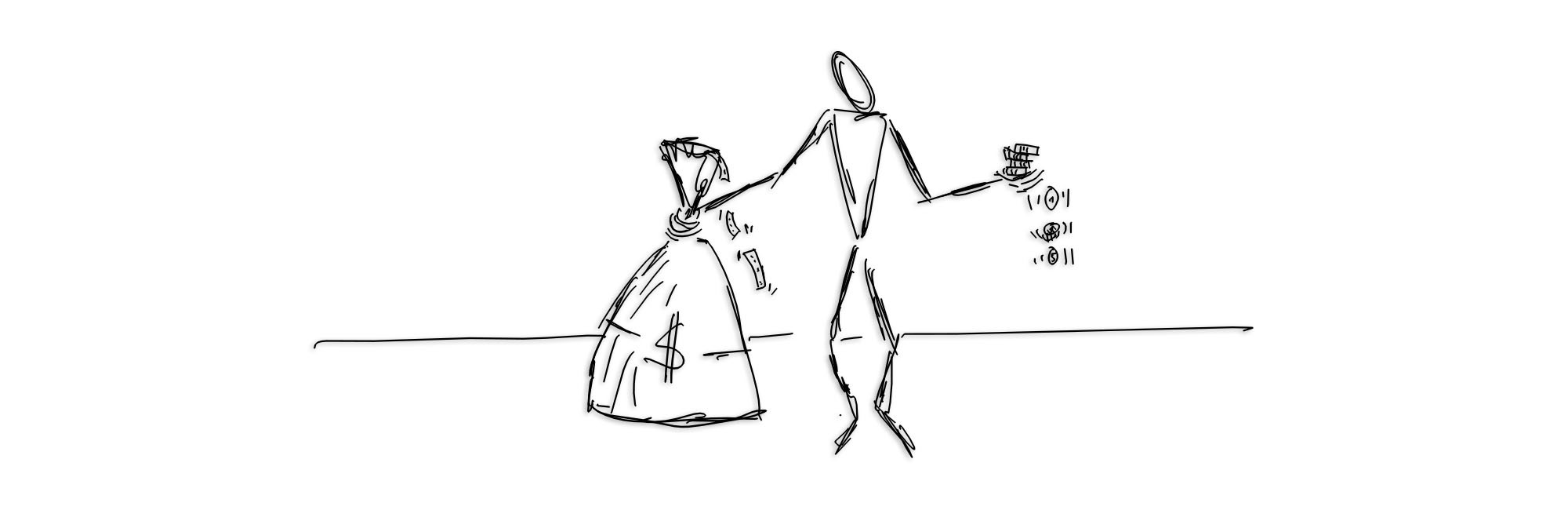Es klingt paradox: Menschen mit grenzenlosem Budget, Zugang zu globalen Netzwerken und Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse scheinen oft bemerkenswert begrenzt in ihrem Denkrahmen zu agieren. Gerade „Eliten“ – insbesondere jene in wirtschaftsliberalen Thinktanks oder unter den Superreichen – vertreten häufig Modelle, in denen der Mensch als soziales Wesen kaum vorkommt. Stattdessen dominieren Effizienzparadigmen, mathematische Modellvorstellungen und Marktlogiken. Wie kann es sein, dass mit so viel Macht so wenig Weitsicht einhergeht?
Der schmale Denkhorizont der Mächtigen
Eliten sind keineswegs per se dumm oder ungebildet. Vielmehr zeigen Studien und Beobachtungen, dass sich innerhalb geschlossener Machtzirkel ein sogenanntes „Groupthink“ ausbilden kann – ein Zustand kollektiver Selbstbestätigung, in dem abweichende Meinungen nicht nur ignoriert, sondern systematisch ausgegrenzt werden. Kognitive Verzerrungen wie der „Confirmation Bias“ führen dazu, dass nur Informationen akzeptiert werden, die die eigene Weltsicht stützen.
In der Praxis bedeutet das: Wer in einem finanzelitären Netzwerk groß geworden ist und sich ausschließlich mit Gleichgesinnten (Homophilie) umgibt, wird selten auf die Idee kommen, dass Wirtschaft auch eine Frage sozialer Verantwortung und nicht nur der Effizienz ist. Der Blick auf die Welt wird enger, nicht trotz, sondern wegen des Einflusses.
Thinktanks als Ideenproduzenten – und Filterblasen
Thinktanks wie das Atlas Network oder die Mont Pèlerin Society sind dafür berüchtigt, wirtschaftsliberale bis libertäre Weltbilder zu zementieren. In der Tradition der „Wiener Schule“ wird der Mensch hier als rationaler Nutzenmaximierer gedacht – ein isoliertes Individuum, das in komplexen Formeln kalkulierbar gemacht werden soll. Emotionen, soziale Bindungen, kulturelle Dynamiken? Fehlanzeige.

Der Einfluss solcher Denkfabriken auf politische Narrative ist enorm. Mit finanzieller Unterstützung von Milliardären wie Charles Koch oder Peter Thiel werden Publikationen, Studien und Medienstrategien entwickelt, die bestimmte ökonomische Vorstellungen in den öffentlichen Diskurs einspeisen. Was fehlt, ist der kritische Realitätsabgleich. Denn diese „Wissenschaft“ ist meist interessengeleitet und ohne wirkliche demokratische Kontrolle.
Der blinde Fleck: Der nicht-besitzende Mensch
Im Denken vieler Eliten taucht eine zentrale Figur kaum auf: der Mensch ohne Kapital. Jene, die zur „working class“ oder zu prekären Schichten gehören, kommen in neoliberalen Modellen oft nur als statistische Variable vor. Ihre Lebensrealitäten – von Unsicherheit, Arbeitsdruck, fehlender Bildungsperspektive – passen nicht ins Bild des souveränen Marktteilnehmers.
Diese Ignoranz hat Folgen. Sie schafft eine Wirtschaftsordnung, die soziale Spannungen nicht nur ignoriert, sondern verstärkt. Wenn wirtschaftspolitische Entscheidungen auf Theorien beruhen, die den Menschen als reinen Kostenfaktor betrachten, dann ist Entfremdung vorprogrammiert. Nicht nur zwischen Reich und Arm, sondern auch zwischen Wirtschaft und Gesellschaft.
Wirtschaft neu denken: Der Mensch im Mittelpunkt
Es gibt Alternativen. Ansätze wie die Gemeinwohlökonomie (Christian Felber), die Postwachstumsökonomie (Niko Paech) oder Modelle des Doughnut Economics (Kate Raworth) stellen den Menschen – nicht das Kapital – ins Zentrum ökonomischen Handelns. Sie plädieren für eine Balance aus sozialer Teilhabe, ökologischer Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Stabilität.
Diese Ideen stoßen jedoch auf massiven Widerstand – nicht nur, weil sie radikal sind, sondern weil sie die Machtbasis bestehender Eliten in Frage stellen. Eine Wirtschaft, die nicht länger auf grenzenlosem Wachstum und Kapitalvermehrung beruht, gefährdet die Legitimation jener, die heute vom Status quo profitieren.
Fazit: Mehr Denken, weniger Denken lassen
Eliten mit unbegrenztem Budget und beschränktem Denkrahmen sind kein Naturgesetz, sondern ein Resultat struktureller Engführungen – ideologisch, sozial, kognitiv. Wer den Anspruch erhebt, Gesellschaften zu gestalten, muss sich auch der Vielfalt menschlicher Bedürfnisse stellen. Es reicht nicht, Modelle zu entwickeln, die im Reißbrett funktionieren, aber im Alltag scheitern.
Vielleicht brauchen wir weniger „Denkfabriken“ – und mehr Räume für echtes, demokratisches Denken. Räume, in denen Besitz nicht über Gehör entscheidet. Und in denen Wirtschaft wieder Mittel zum Zweck wird: dem guten Leben für alle.