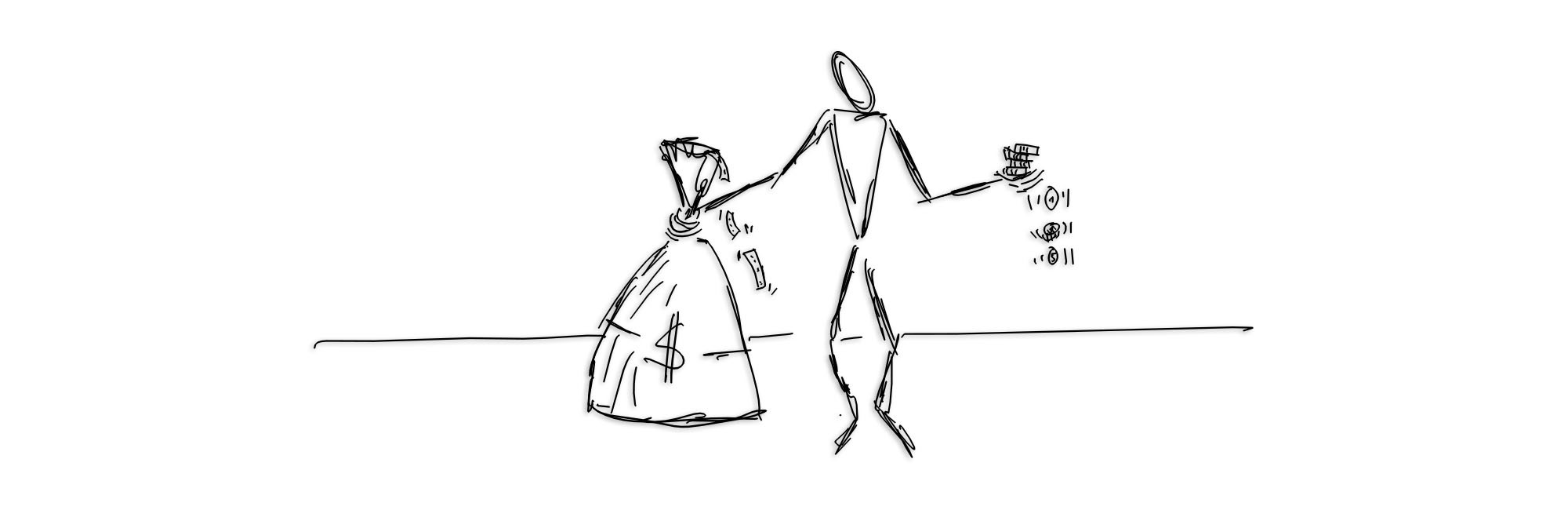Wer heutzutage in die Welt des Geldes blicken will, stolpert schnell über eine erstaunliche Metamorphose: Aus ehemals wertgebundenen Tauschmitteln sind abstrakte Zahlenkolonnen geworden – beliebig erweiterbar, entkoppelt von greifbarer Substanz und oft genug Spielball menschlicher Gier und technischer Fälschung. Doch wie kam es zu dieser Verwandlung? Und was können uns vergangene Finanzkrisen über den Umgang mit Geld lehren?
Vom Wertäquivalent zur seelenlosen Zahl
Ursprünglich war Geld ein Wertäquivalent – meist Gold oder Silber –, an dem sich der Wert von Waren und Dienstleistungen orientierte. Es war eine physische, wenn auch begrenzte, Manifestation von Wert. Goldmünzen glänzten nicht nur im Beutel, sie vermittelten fühlbar die Sicherheit, dass ihnen tatsächlich ein Gegenwert innewohnte. Ebenso sogenannte Silberlinge, deren Gewicht – nicht die hübsche Prägung – über ihre Kaufkraft entschied. Je weiter zurück in der Geschichte, desto näher lag der materielle Wert am Nennwert, und jede neue Münze bedeutete auch eine neue Portion an staatlich verbrieftem Versprechen und Edelmetall.
Doch wuchs mit Wirtschaft, Handel und staatlicher Macht die Versuchung – und Notwendigkeit –, mehr Geld in Umlauf zu bringen, als unter der Erde gefunden werden konnte. Erste Belege für das „Strecken“ des Edelmetallgehalts, also das heimliche Untermischen günstigerer Metalle, stehen am Anfang eines langen Weges: dem der schleichenden Entkopplung von materieller Substanz und Geldwert. Im Laufe der Jahrhunderte wurden Münzen immer weniger wertbeständig, immer willkürlicher. Spätestens mit der Erfindung des Papiergeldes im China der Tang-Dynastie (7. Jh.), das rund ein Jahrtausend später auch in Europa Fuß fasste, wurde Geld vor allem—aber nicht mehr ausschließlich—ein Versprechen: Die Banknote versprach einen Anspruch auf eingelöstes Edelmetall.
[Wikipedia: Papiergeld]
Diese Kopplung an Gold oder Silber blieb lange Zeit das Fundament moderner Geldordnungen. Ihre letzte große Bastion war das 1944 installierte Bretton-Woods-System, das den US-Dollar mit Gold und alle anderen Währungen mit dem Dollar verknüpfte. Die Stabilität schien garantiert—bis sich herausstellte, dass das Emittieren von Dollars für den Vietnamkrieg und die Wirtschaft der Nachkriegsjahre deutlich schneller ging als das Schürfen neuen Goldes. Als die USA erkannten, dass zu viele Dollar in Umlauf und zu wenig Gold in Fort Knox lag, zog Richard Nixon 1971 die Reißleine: Der „Nixon-Schock“ hob die Umtauschpflicht von Dollar gegen Gold auf. Ein fundamentaler Epochenwechsel: Von da an war das Geld nur noch Papier – oder schon bald rein elektronische Buchung.
Das Fiat-Geldsystem1 war geboren: Der Wert des Geldes basiert seitdem allein auf dem Vertrauen in die ausgebende Zentralbank und den Staat. Mit dem Wegfall der Golddeckung wurde die Geldmenge theoretisch grenzenlos erweiterbar.
Die Folgen sind bis heute spürbar: Der Wert der Währungen schwankt, Inflationsängste und Währungskrisen gehören zur neuen Normalität. Zentralbanken können mittels Geldschöpfung massive Wirtschaftspolitik betreiben – manchmal rettend, manchmal riskant. Gleichzeitig „entmaterialisiert“ sich Geld immer weiter. Es verschwindet als Münze oder Schein, wandert auf digitale Konten und wird in „Bits und Bytes“ zu abstrakter, beinahe seelenloser Zahl. Die psychologische Distanz zum eigenen Reichtum wächst: Ein Klick auf dem Smartphone ersetzt den Goldklumpen in der Hand.
Kurios und zugleich bezeichnend: Heute werden Billionenbeträge rund um den Globus bewegt, von denen kein einziger Cent oder Penny mehr physisch existiert. Ihre Kaufkraft ist so real wie das Vertrauen an die Institutionen, die die Zahlen verwalten – aber so flüchtig, wie kollektives Vertrauen es eben sein kann. Was bleibt, ist ein Nachdenken über Geld: Wie viel ist es uns wert, warum vertrauen wir darauf – und wie schnell kann die seelenlose Zahl zur brüchigen Illusion werden?
Geld als numismatische Schönheit
Doch nicht alle Geldformen sind bloß nüchterne Zahlen. Die Numismatik – die Kunst und Wissenschaft der Münzkunde – erinnert uns an die ästhetische Dimension von Geld. Münzen sind kleine Kunstwerke, Zeugnisse verschiedener Kulturen, Epochen und Technologien. Vom alten griechischen Drachmen bis zu den prächtigen Renaissance-Goldmünzen erzählen sie Geschichten von politischer Macht, kultureller Identität und wirtschaftlichem Austausch.
Vor der Verbreitung klassischer Münzen setzten Kulturen weltweit ungewöhnliche Formen von Geld ein, die oft auch ästhetisch und symbolisch bedeutend waren. So etwa das Muschelgeld, das in vielen Küstenregionen Afrikas, Asiens und im Pazifik als Zahlungsmittel diente. Die sorgfältig gesammelten und geschnittenen Muscheln galten nicht nur als Zahlungsmittel, sondern auch als Symbol für Status und soziale Bindungen – ein natürliches Kunstwerk, das eine Brücke zwischen Ästhetik und Wert bildete.
In Europa fanden sich im frühen Mittelalter Messergeld – metallene Geldformen, die an kleine Messer erinnerten oder die Form von Messerklingen hatten. Sie waren Vorläufer der Münzen und symbolisierten Schutz, Ernte und Wert. Diese Metallstücke hatten oft dekorative Gravuren und spiegelten lokale handwerkliche Kunstfertigkeit wider.
Ein besonders faszinierendes Kapitel schrieb das Brakteaten-Geld, das im Hochmittelalter vor allem im deutschsprachigen Raum verbreitet war. Diese dünnen, einseitig geprägten Münzen, oft aus Silber, zeigen kunstvolle, manchmal fast filigrane Motive von Herrschern, Heiligen oder floralen Mustern. Trotz ihrer fragilen Erscheinung waren Brakteaten ein wichtiges Zahlungsmittel und gleichzeitig Ausdruck künstlerischer Identität.

Nicht zuletzt wurden in einigen Kulturen Eberzähne als Tauschmittel verwendet – etwa bei Stämmen in Teilen Afrikas und Asiens. Die Zähne symbolisierten nicht nur materiellen Wert, sondern trugen auch Assoziationen von Stärke und Mut. Ihre natürliche Form und Seltenheit machten sie zu einem lebendigen Geld, das weit über bloße Transaktionen hinaus soziale und kulturelle Bedeutung besaß.
Diese vielseitigen Zahlungsmittel zeigen, dass Geld über seinen reinen Tauschwert hinaus immer auch kulturelles Kapital war. Mit jeder Form spiegelt sich ein Stück Menschheitsgeschichte – eine Verbindung von Ästhetik, Technik und sozialer Bedeutung, die heute oft in der digitalen Währung verloren gegangen scheint.
Geld und Gier: Lehren aus Finanzkrisen
Ist Geld Triebfeder der Gier? Ein schwieriges Thema, bei dem sich bitterste Lektionen in Geschichte und Gegenwart finden lassen. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 zeigte eindrücklich, wie Gier, Überschwang und mangelnde Vorsicht ganze Volkswirtschaften in den Abgrund reißen können. John Kenneth Galbraith beschrieb das Geschehen als „Geschichte der Gier und Überheblichkeit“2. Die euphorischen Börsenspekulationen, ausgelöst durch rapide steigende Aktienkurse und unverhältnismäßige Kreditaufnahme, führten zum berühmten „Schwarzen Donnerstag“ und der darauffolgenden Kettenreaktion, die das globale Finanzsystem nahezu lahmlegte.
Auch die Finanzkrise 2008 war kein neues Phänomen, sondern offenbarte erstaunliche Parallelen: exzessive Schuldenaufnahme, riskante Kreditvergaben (Stichwort: Subprime), und eine maßlose Gier nach kurzfristigen Gewinnen, die langfristige Stabilität geopfert haben[1][3][10]. Die Auswirkungen waren dramatisch – Bankenrettungen auf Kosten der Steuerzahler, staatliche Rettungspakete und eine weitreichende Vertrauenskrise gegenüber den globalen Finanzmärkten.
Interessanterweise zeigen aktuelle Studien und ökonomische Analysen, dass die Ursachen der Krisen nicht allein im „bösen“ Verhalten der Menschen – sprich Gier – zu suchen sind. Vielmehr spielen auch fehlgeleitete Geldpolitik und ungenügende Regulierungen eine zentrale Rolle. So verstärkte eine kontraktive Haltung der Zentralbanken die Krise 1929, indem sie die Geldmenge verknappten und so die wirtschaftliche Erholung erschwerten – ein Fehler, der auch 2008 mit anfänglich zu zögerlichem Eingreifen der Fed und anderen Notenbanken wiederholt wurde[5]3.
Darüber hinaus trägt die zunehmende Komplexität der Finanzmärkte zur Verwundbarkeit bei. Neue Finanzprodukte (wie Derivate oder CDOs), unkontrollierte Hebelwirkung und die globale Vernetzung machten beide Krisen zu explosiven Gemischen, die durch einzelne Funktionsstörungen enorme Kaskadeneffekte entfachen konnten.
Die Lehre daraus: Gier allein reicht nicht als Erklärung, sondern muss eingebettet werden in ein System aus menschlichem Verhalten, institutionellen Rahmenbedingungen, technologischer Entwicklung und politischer Steuerung. Krisen sind sowohl Symptome als auch Resultate dieses fragilen Zusammenspiels – und Sensibilität für alle Ebenen ist notwendig, um aus Fehlern der Geschichte zu lernen.
Geld und Fälschung – Von „Beschneiden“ bis zur Druckplatte
Die Angst vor Geldfälschung ist fast so alt wie das Geld selbst. In frühen Zeiten, als Münzen noch aus Edelmetallen bestanden, war das „Beschneiden“ ein verbreiteter Trick: Händler oder Besitzer rieben an den Rändern der Münzen, um kleine Mengen Gold oder Silber abzuschneiden und so das Metall zu „schneiden“, ohne den Münzwert ganz zu verlieren. Damit verringerte sich natürlich der tatsächliche Materialwert, während die Münze noch als voller Wert zirkulierte – ein krimineller Vorgang mit erheblichen Folgen für das Vertrauen ins Geld.
Mit der zunehmenden Verbreitung von Banknoten im Spätmittelalter und Neuzeit wandelte sich der Kampf gegen die Fälschung. Das Drucken von Geld wurde zur technologischen Herausforderung und erforderte immer ausgefeiltere Sicherheitsmaßnahmen. So entstanden spezielle Wasserzeichen, eingeprägte Reliefs, metallische Fäden und fluoreszierende Elemente als Sicherheitsmerkmale. Die Erfindung der mehrfarbigen Druckverfahren und mikrofeiner Details erschwerte Fälschern das Kopieren enorm.
Die Druckplatte selbst verbirgt eine eigene Geschichte: Hochwertige Gravuren wurden händisch gefertigt – ein Kunsthandwerk, das Fälschern das Handwerk legen sollte. Präzise geätzte Linien, aufwendige Muster und kleine Symbole machen das Nachahmen äußerst schwierig. Trotz all dieser Schutzmaßnahmen sind Fälschungen dennoch immer wieder aufgetaucht – ein Wettlauf zwischen Sicherheitsdruckern und Betrügern, der bis heute anhält.
Mit dem Aufkommen der Digitalisierung und der elektronischen Zahlungswege änderten sich die Herausforderungen grundlegend. Moderne Währungen verwenden digitale Signaturen, kryptographische Verfahren und Blockchains, um Fälschungen auf rein physischer Basis zu verhindern und das Vertrauen in digitales Geld zu sichern. Kryptowährungen wie Bitcoin setzen komplett auf diese Techniken, um Transaktionen transparent und manipulationssicher zu gestalten.
Aber neue Technologien eröffnen auch neue Angriffsflächen: Cyberkriminalität, Hacking von Zahlungssystemen und die Erzeugung falscher digitaler Assets sind die Fälschungsprobleme unserer Zeit. Gleichzeitig entwickeln Finanzinstitute und Staaten immer komplexere Verfahren – wie biometrische Authentifizierung, KI-gestützte Anomalieerkennung und multifaktorielle Sicherheitssysteme –, um Betrug zu verhindern.
Die Geschichte der Geldfälschung zeigt: Geld braucht Sicherheit nicht nur als technisches, sondern auch als gesellschaftliches Fundament. Vertrauen ist die wichtigste „Währung“ – und jede Innovation bei der Fälschungsbekämpfung ist letztlich ein Kampf um dieses Vertrauen.
Geld und Macht: Vom Prägerecht zur Kontrolle durch Zentralbanken
Geld war schon immer mehr als nur ein Tauschmittel – es ist ein machtvolles Symbol. Die Kontrolle über das Prägerecht war jahrhundertelang ein zentrales Instrument politischer Macht. Nur Herrscher, Fürsten oder autorisierte Münzstätten durften Münzen herstellen, was ihnen direkte Kontrolle über die Geldmenge und den Wert der Währung gab. Die Qualität und der Materialwert der Münzen waren dabei ein sichtbares Zeichen von Souveränität und Vertrauen: Edelmetalle wie Gold, Silber oder Kupfer verliehen den Münzen nicht nur materiellen, sondern auch intrinsischen Wert.
Durch das Prägerecht konnte ein Herrscher nicht nur Geld herstellen, sondern oft auch mit dem sogenannten Seigniorage-Effekt profitieren – der Differenz zwischen Materialwert und Nennwert. In Krisenzeiten wurde diese Macht auch missbraucht: Münzen wurden absichtlich „verschlechtert4“, um kurzfristig finanzielle Mittel zu beschaffen. Dieses Verfahren verringerte jedoch das Vertrauen in die Währung und führte häufig zu Inflation oder inneren Unruhen.
In der Neuzeit entwickelte sich die Geld-Macht weiter und wandelte sich – trotz des formalen Ende vieler Metallwährungen – nicht geringfügig. Die Aufhebung der Goldbindung (siehe Abschnitt „Vom Wertäquivalent zur seelenlosen Zahl“) entmachtete zwar die physische Basis des Geldes, gab aber den Zentralbanken eine neue, enorme Macht: die Möglichkeit, Geld per Knopfdruck zu schaffen, Wirtschaft zu steuern und politische Ziele zu verfolgen. Die Kontrolle über Geldpolitik, Zinssätze und Liquidität ist heute ein machtvolles Werkzeug nationaler und globaler Politik – mit weitreichenden Folgen für Bürger, Unternehmen und Staaten.
So ist Geld-Macht in der Neuzeit weniger sichtbar als eine prägerechtlich geschützte Münze, aber ebenso wirkmächtig. Sie liegt in der Fähigkeit, Vertrauen zu erhalten, Geldströme zu lenken und Krisen zu verhindern oder herbeizuführen. Staatliche und supranationale Institutionen, aber auch zentrale Banken, sind heute die neuen „Münzherren“. Deshalb sind Transparenz, Kontrolle und demokratische Legitimation in der Geldpolitik entscheidend, um Machtmissbrauch zu verhindern und das Gleichgewicht zwischen Freiheit, Stabilität und Wachstum zu wahren.
Geld und Gier: Lehren aus Finanzkrisen
Ist Geld Triebfeder der Gier? Ein schwieriges Thema, bei dem sich bitterste Lektionen in Geschichte und Gegenwart finden lassen. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 zeigte eindrücklich, wie Gier, Überschwang und mangelnde Vorsicht ganze Volkswirtschaften in den Abgrund reißen können. John Kenneth Galbraith beschrieb das Geschehen als „Geschichte der Gier und Überheblichkeit“5. Die euphorischen Börsenspekulationen, ausgelöst durch rapide steigende Aktienkurse und unverhältnismäßige Kreditaufnahme, führten zum berüchtigten „Schwarzen Donnerstag“ und lösten eine Kettenreaktion aus, die das globale Finanzsystem nahezu lahmlegte.
Auch die Finanzkrise 2008 war kein neues Phänomen, sondern offenbarte erstaunliche Parallelen: exzessive Schuldenaufnahme, riskante Kreditvergaben (etwa durch Subprime-Hypotheken), und eine maßlose Gier nach kurzfristigen Gewinnen, die langfristige Stabilität geopfert haben[1][3][10]. Die Konsequenzen waren dramatisch: Bankenrettungen auf Kosten der Steuerzahler, umfangreiche staatliche Rettungspakete und eine anhaltende Vertrauenskrise gegenüber den globalen Finanzmärkten.
Die Zäsur liegt jedoch nicht nur im Verhalten der Einzelakteure, sondern auch in der Systemarchitektur und der Geschwindigkeit, mit der sich Entwicklungen heute entfalten. Die zunehmende Schnelligkeit des modernen Aktienhandels, besonders durch algorithmische Handelssysteme und Hochfrequenzhandel (HFT), potenziert diese Dynamiken. Algorithmen agieren innerhalb von Mikrosekunden und reagieren oft nicht auf rationale Fundamentaldaten, sondern auf kleinste technische Signale oder Preisbewegungen. Dadurch verstärken sie die Volatilität und können spekulative Blasen oder Crashs massiv beschleunigen6.
Dieses algorithmisch gesteuerte Schwarmverhalten führt nicht selten zu irrationalen Marktentwicklungen: Kleine Kursausschläge lösen automatisch umfangreiche Handelswellen aus, die selbstverstärkend wirken. Heute sind es immer weniger Bauchgefühl und menschliche Einschätzung, sondern komplexe Codes, die den Takt an der Börse angeben. Die enorme Reaktionsgeschwindigkeit macht es für Menschen praktisch unmöglich, Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen oder gegenzusteuern. So entstehen nicht nur Chancen für schnelle Gewinne, sondern auch immense Risiken für das globale Finanzsystem.
Eine weitere Erkenntnis aus beiden Krisen lautet: Gier ist ein menschliches Naturphänomen, doch sie wird von Strukturen, Regeln und Technologien entweder gebrochen oder befeuert. Unzureichende Regulierung, mangelnde Transparenz, zu komplexe Finanzprodukte und fehlende Aufsicht schufen ein Klima, in dem Gier unkontrolliert eskalieren konnte. Lehren daraus sind vielfältig – von einer verbesserten Finanzmarktregulierung über solide Aufsichtsinstrumente bis hin zu politischer und gesellschaftlicher Sensibilisierung für die Folgen ungebremster Spekulation.
Insgesamt zeigen die Finanzkrisen eindrücklich, dass Geld nicht nur ein neutraler Wertindikator ist. Es kann zum Motor für menschliche Schwächen wie Gier werden und – verstärkt durch technologische Entwicklungen – enorme Instabilität erzeugen. Doch gerade in der Reflexion dieser Krisen liegt auch die Chance: Ein verantwortungsvoll gestaltetes Finanzsystem kann zum Motor für nachhaltigen Wohlstand werden – wenn Mensch, Technik und Regulierung ihr Gleichgewicht finden.
Vom Bauchgefühl zum Algorithmus – Aktienhandel und die Wirkung kleinster Ausschläge
Wo einst erfahrene Händler vor allem auf ihr Bauchgefühl, intensive Marktkenntnis und fundierte Analyse setzten, dominieren heute hochkomplexe Algorithmen die Börsen. Diese Programme, oft mit Künstlicher Intelligenz oder modernen Analyseverfahren ausgestattet, reagieren innerhalb von Millisekunden auf kleinste Kursveränderungen – und das in einem Umfang, der menschliches Handeln bei weitem übersteigt.
Automatisierte Handelssysteme analysieren nicht nur Preisbewegungen, sondern auch Nachrichten, Tweets, Marktstimmungen oder sogar Wetterdaten und setzen daraufhin gewaltige Handelsvolumina in Bewegung. Die Folge: Schon minimalste Ausschläge am Kurs können via algorithmischer Kettenreaktion eine Lawine von Kauf- oder Verkaufsaufträgen auslösen, die Preise stark verzerren und so zu plötzlichen Marktturbulenzen führen.
Dieses Phänomen wird häufig als „Flash Crash“ bezeichnet – Momente, in denen innerhalb von Sekunden oder Minuten scheinbar grundlos dramatische Kursstürze oder ebenso schnelle Erholungen stattfinden. Ein berühmtes Beispiel war der Flash Crash am 6. Mai 2010, als der Dow Jones Index innerhalb von Minuten um fast 1.000 Punkte sank, bevor er sich schnell wieder erholte. Die Ursache: algorithmisch getriebene Verkaufsorder, die sich selbst verstärkten und menschliche Eingriffe praktisch ausschlossen.
Das Risiko liegt in mehreren Dimensionen: Zum einen verlassen sich die Systeme auf vorgegebene Parameter und Wahrscheinlichkeiten, reagieren jedoch nicht immer „vernünftig“ im Sinne tiefer wirtschaftlicher Fundamentaldaten. So können Fehlsignale und Überreaktionen entstehen, die den Markt kurzfristig irrational agieren lassen. Zum anderen führt die schiere Geschwindigkeit dazu, dass menschliche Intervention oft zu spät kommt, um eingreifen oder korrigieren zu können.
Ein weiterer kritischer Punkt ist die gegenseitige Vernetzung der Algorithmen: Handelsroboter „sehen“ die Aktionen anderer Algorithmen nicht nur als Handelssignale, sondern reagieren darauf in Echtzeit – teils reflexartig und selbstverstärkend. Dieses Schwarmverhalten lässt Märkte anfälliger werden für Volatilität, Blasenbildung oder plötzliche Einbrüche, die durch menschliches Entscheiden schwer vorhersehbar sind.
Mit dieser Entwicklung verlässt der Aktienhandel zunehmend den Bereich der individuellen Analyse und des erfahrungsbasierten Urteils. Stattdessen beherrschen „Black Boxes“ mit undurchsichtigen Entscheidungslogiken die Märkte, deren Risiken von Regulatoren und Marktteilnehmern nur schwer zu durchschauen und zu kontrollieren sind. Das nährt die Debatte über die Effizienz freier Märkte und die Notwendigkeit strengerer Aufsicht oder gar technologischer Grenzen für Hochfrequenzhandel.
Abschließend lässt sich sagen: Die Umwandlung des aktienbasierten Kapitalmarkts vom von Menschen geprägten Bauchgefühl und Detailwissen zum algorithmisch dominierten System ist ein tiefgreifender Wandel, der neue Chancen, aber auch erhebliche Risiken birgt. Die Herausforderung besteht darin, Technologie sinnvoll zu nutzen, ohne die Marktstabilität und das Vertrauen der Anleger aufs Spiel zu setzen.
Fazit
Geld ist weit mehr als nur ein Mittel zum Tausch – es ist ein vielschichtiges Phänomen, das technische Innovationen, wirtschaftliche Entwicklungen, menschliche Geschichte und ethische Fragestellungen miteinander verwebt. Vom ursprünglichen materiellen Wertäquivalent, das eng an Gold oder Silber gebunden war, hin zur heute dominierenden seelenlosen Zahl in digitalen Systemen, ist Geld zu einer sozialen Konstruktion geworden, die ständig neu gedacht und verantwortungsvoll gestaltet werden muss.
Die Finanzkrisen der Vergangenheit und Gegenwart zeigen uns deutlich die dunklen Seiten menschlicher Gier, aber auch die Grenzen eines Systems, in dem Vertrauen, Regulierung und Bildung oft zu kurz kommen. Nur durch Weitsicht, klare Regeln und eine informierte Gesellschaft kann Geld als verantwortungsvoller Motor für nachhaltigen Wohlstand dienen – statt als Auslöser von Instabilität und Ungerechtigkeiten.
Und nicht zuletzt erinnert uns die numismatische Schönheit vergangener Zeiten daran, dass Geld immer auch ein Träger von Kultur, Identität und Geschichte ist. Es sollte niemals auf eine rein abstrakte Zahl reduziert werden, sondern stets als ein lebendiges Spiegelbild menschlicher Zivilisation wahrgenommen werden – mit all ihren Facetten, Herausforderungen und Hoffnungen.
Quellen und weiterführende Literatur
- Süddeutsche Zeitung – Finanzkrise 1929 und 2008: Ein umfassender Vergleich der beiden großen Wirtschaftskrisen und ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede, inklusive Analysen zu Gier und Finanzmarktversagen.
- Seminararbeit: Die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 – TU Wien: Fundierte Analyse der Ursachen und Folgen der Finanzkrise 2008 mit Rückbezug auf die Weltwirtschaftskrise von 1929.
- Wikipedia: Weltwirtschaftskrise: Basisinformationen zur Krise von 1929 mit historischen Hintergründen und weiterführenden Quellen.
- Deutsche Bundesbank: Geldfälschung und Sicherheit: Erläuterungen zu historischen und modernen Methoden der Geldfälschung und deren Bekämpfung.
- Bundeszentrale für politische Bildung: War 2008 das neue 1931?: Ein Vergleich der Finanzkrise 2008 mit der historischen Wirtschaftskrise und deren gesellschaftspolitischen Auswirkungen.
- Schweizerische Nationalbibliothek: Wirtschaftskrisen 1929 und 2008: Sammlung von Dokumenten und wissenschaftlichen Analysen zur Berichterstattung und Wahrnehmung der beiden Krisen in der Schweiz.
- ZDF: Die großen Crashs – Dokumentation: Video-Dokumentationen zu den bedeutendsten Wirtschaftskrisen, u.a. 1929 und 2008.
- Wirtschaftsdienst: Bankenkrise – Ursachen und Maßnahmen: Fachbeitrag zur Analyse der Ursachen der Finanzkrise und den darauf folgenden Maßnahmen.
- Gerd Kommer: Die Wahrheit über den Aktiencrash von 1929: Detaillierte Betrachtung des Börsencrashs von 1929 und differenzierte Einordnung der Ereignisse.