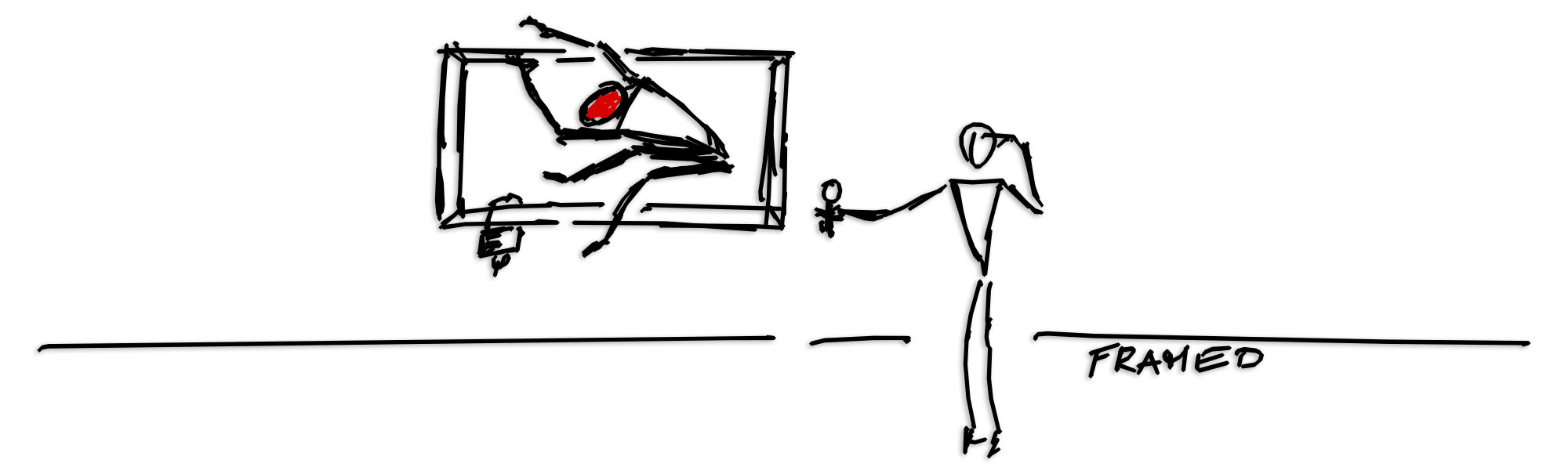Die Wahrnehmung von „grüner Politik“ ist stark durch Sprache und Bilder geprägt. Kritiker sprechen von einer „Körnerfresser-Politik“, während Befürworter nachhaltige Zukunftskonzepte betonen. Doch wie sehr wird unser Bild von den Grünen durch Framing beeinflusst? Wer betreibt dieses Framing und warum wirkt es so effektiv?
Von Turnschuhen und Häkelnadeln – Die frühen Grünen
In den 1980er Jahren galten die Grünen als Protestpartei mit unkonventionellen Mitteln. Die Bilder von Joschka Fischer in Turnschuhen während seiner Vereidigung als hessischer Umweltminister 1985 oder von der Abgeordneten Petra Kelly, die zusammen mit Gert Bastian für eine pazifistische Wende in der Politik kämpfte, haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Auch die Abgeordnete Waltraud Schoppe, die sich mit ihrer Forderung nach einer offenen Geschlechterpolitik für die Rechte von Frauen und gegen patriarchale Strukturen im Bundestag einsetzte, sorgte für Aufsehen.
Dieses Image von Weltfremdheit wurde bewusst medial verstärkt, um die Partei als nicht regierungsfähig darzustellen. Konservative Kreise und Teile der etablierten Parteien, allen voran CDU und FDP, nutzten gezielt die als provokant empfundenen Auftritte grüner Abgeordneter, um deren Seriosität infrage zu stellen. Die Boulevardpresse griff ungewöhnliche Szenen aus dem Bundestag auf, darunter das Stillen der Grünen-Abgeordneten Ingrid Matthäus-Maier, und stilisierte sie zu Symbolen für eine vermeintliche Unordnung und mangelnde Professionalität der neuen Partei.
Gleichzeitig schafften es die Grünen trotz der medialen Angriffe, sich als wichtige Stimme für Umwelt- und Friedenspolitik zu etablieren. Insbesondere im Zuge der Anti-Atomkraft-Bewegung und der Proteste gegen die Nachrüstungspolitik der NATO fanden sie wachsenden Zuspruch, insbesondere bei jungen Wählern und engagierten Bürgerinitiativen. Die Partei wandelte sich langsam von einer basisdemokratischen Protestbewegung hin zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft – ein Prozess, der sich in den folgenden Jahrzehnten weiter fortsetzte.
Wer betreibt das Framing?
Framing ist ein mächtiges Werkzeug der politischen Kommunikation und wird gezielt eingesetzt, um Wahrnehmungen zu beeinflussen. In Bezug auf die Grünen sind es vor allem politische Gegner wie die CDU und FDP, konservative Medien wie die Bild-Zeitung und wirtschaftsnahe Interessengruppen wie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), die das Narrativ der Weltfremdheit fördern.
Durch gezielte Berichterstattung und selektive Darstellungen werden bestimmte Bilder verstärkt – etwa grüne Politiker, die in symbolträchtigen Aktionen wie Baumbesetzungen oder Demonstrationen gegen Kohlekraftwerke auftreten. Gleichzeitig werden andere Aspekte, wie die wirtschaftliche Tragfähigkeit grüner Politik oder erfolgreiche grüne Regierungsbeteiligungen auf Landesebene, bewusst in den Hintergrund gerückt.
Warum wirkt Framing überhaupt?
Framing funktioniert, weil Menschen Informationen nicht neutral aufnehmen, sondern sie in bestehende Denkmuster einordnen. Einmal etablierte Bilder – wie das des „Körnerfressers“ oder des „naiven Idealisten“ – beeinflussen, wie neue Informationen bewertet werden. Wenn eine Partei über Jahre hinweg als realitätsfern dargestellt wird, fällt es schwer, neue Narrative dagegen zu setzen.
Hinzu kommt, dass einfache, emotional aufgeladene Botschaften oft besser haften bleiben als komplexe, differenzierte Argumente. Wenn „grüne Politik“ mit Verboten, Verzicht oder wirtschaftlichen Nachteilen verknüpft wird, prägt das die Wahrnehmung der Wähler und Wählerinnen nachhaltig. Medienmanipulation und Wahrnehmung zeigt weitere Mechanismen auf, die hier eine Rolle spielen.
Framing: Die Grünen als realitätsferne Ideologen?
Die Kritik an grüner Politik erfolgt oft mit dem Vorwurf der Weltfremdheit. Politische Gegner wie CDU und FDP, wirtschaftsnahe Lobbyverbände wie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sowie konservative Medien wie die Bild-Zeitung oder die Welt greifen gezielt Narrative auf, die grüne Maßnahmen als unrealistisch oder wirtschaftsschädlich darstellen.
Dabei werden zentrale politische Forderungen der Grünen, etwa ambitionierter Klimaschutz, eine nachhaltige Energiepolitik oder soziale Gerechtigkeit, häufig als überzogen oder nicht praktikabel abgetan – oft, ohne ernsthaft über deren langfristige Zukunftsfähigkeit zu diskutieren. So wurden Vorschläge zur Förderung erneuerbarer Energien lange Zeit als zu teuer oder unzuverlässig gebrandmarkt, obwohl sie mittlerweile in vielen Ländern eine tragende Rolle in der Energieversorgung spielen.
Ein Beispiel für diese Form des Framings war die Debatte um das Verbot neuer Verbrennungsmotoren in der EU. Kritiker inszenierten es als ideologisch motivierten Angriff auf die Automobilindustrie, während der eigentliche Zweck – die Förderung emissionsfreier Mobilität – in den Hintergrund rückte. Solche Verzerrungen zeigen, wie Framing eine sachliche Debatte erschweren kann und bestimmte Reformen emotional aufgeladen werden, anstatt sie auf ihre praktischen Auswirkungen hin zu bewerten.
Hat sich das Bild geändert?
Heute sind die Grünen eine etablierte Partei teilweise sogar mit Regierungsverantwortung. Politiker wie Annalena Baerbock oder Robert Habeck entsprechen optisch und rhetorisch längst nicht mehr dem Bild der frühen Grünen, das durch bunte Pullover, Protestaktionen und basisdemokratische Chaotik geprägt war.
Sie agieren professionell, staatstragend und pragmatisch – und doch hält sich das alte Framing der Weltfremdheit hartnäckig. Oft wird es durch politische Gegner und mediale Narrative gezielt verstärkt, um Zweifel an ihrer Regierungsfähigkeit zu schüren.
Besonders bei Wirtschaftsminister Robert Habeck zeigt sich, wie sich solche Wahrnehmungen verschieben können. Wurde er anfangs als naiver Idealist belächelt, erweisen sich viele seiner wirtschaftspolitischen und energiepolitischen Weichenstellungen inzwischen als richtig – selbst von politischen Gegnern wird das hinter vorgehaltener Hand anerkannt.
Besonders in der Energiekrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine bewies Habeck Krisenmanagement und handelte pragmatisch, indem er kurzfristig auf Flüssiggas setzte, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Viele Maßnahmen, die anfangs als utopisch oder wirtschaftsfeindlich galten, werden heute von der Opposition als eigene Errungenschaften dargestellt.
Außenministerin Annalena Baerbock wiederum hat sich in eigentlich katastrophalen diplomatischen Situationen mit Bravour geschlagen. Trotz multipler globaler Krisen – vom Ukraine-Krieg bis zu Spannungen mit China – hat sie keine unnötigen Krisen ausgelöst und die deutsche Außenpolitik stabil gehalten. Dabei wird sie in der öffentlichen Berichterstattung jedoch häufig weniger als Politikerin denn als Frau bewertet. Ihre Kleidung, ihr Auftreten oder ihr Privatleben stehen oft mehr im Fokus als ihre diplomatischen Erfolge – ein Muster, das sich besonders bei Frauen in der Politik beobachten lässt.
Fazit: Der Einfluss von Framing
Die Wahrnehmung grüner Politik wird weiterhin stark von historischen Bildern geprägt. Während sich Inhalte und Akteure verändert haben, bleibt das Framing oft dasselbe. Noch immer werden grüne Politikerinnen und Politiker mit alten Stereotypen konfrontiert – sei es das Bild der naiven Weltverbesserer, der wirtschaftsfeindlichen Ideologen oder der realitätsfernen Aktivisten. Dabei hat sich die Partei längst professionalisiert, regiert in Bund und Ländern mit und gestaltet Politik auf internationaler Ebene mit.
Dennoch greifen politische Gegner und Teile der Medien oft auf diese alten Narrative zurück, um die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen. Besonders in Krisensituationen zeigt sich, dass die Grünen anders bewertet werden als andere Parteien: Während wirtschaftspolitische Fehleinschätzungen oder Kurskorrekturen bei CDU oder SPD als pragmatisch oder notwendig dargestellt werden, gelten sie bei den Grünen schnell als Beweis für Inkompetenz oder mangelnde Regierungsfähigkeit.
Eine faire politische Auseinandersetzung erfordert jedoch eine differenzierte Betrachtung jenseits von Klischees. Erst wenn Framing erkannt und hinterfragt wird, kann eine offene Diskussion über die Zukunftsfähigkeit grüner Politik stattfinden. Das gilt nicht nur für die Grünen selbst, sondern für alle politischen Kräfte, die mit vereinfachten oder verzerrten Darstellungen zu kämpfen haben. In einer Zeit, in der Mediennarrative einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben, wird es umso wichtiger, die Mechanismen hinter der Berichterstattung zu verstehen.