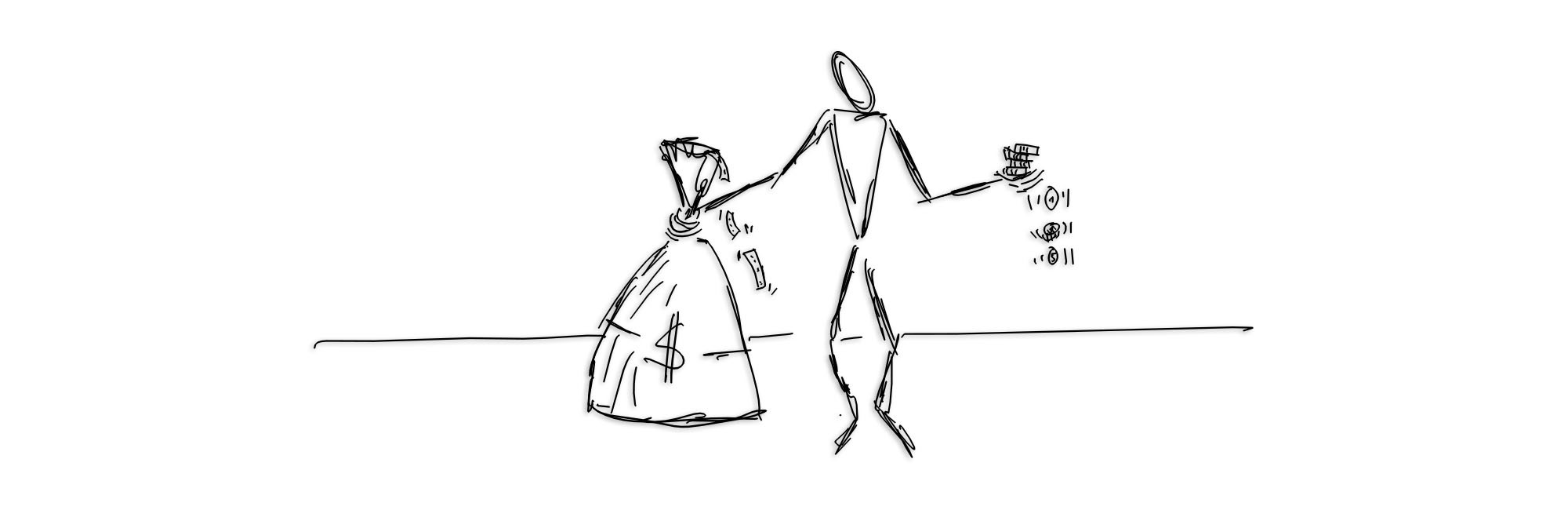Die Gewinnmaximierung gilt in der klassischen Betriebswirtschaftslehre als zentrales Ziel unternehmerischen Handelns. Doch wie sinnvoll ist dieses Mantra heute noch – und welche Nebenwirkungen entstehen, wenn Unternehmen sich ausschließlich daran orientieren?
Das Konzept der Gewinnmaximierung – also der Versuch, den Unterschied zwischen Gesamterlös und Gesamtkosten zu maximieren – ist mathematisch und betriebswirtschaftlich klar definiert. Kurzfristig kann dies durch Preiserhöhungen, Effizienzsteigerungen oder Kostensenkungen erreicht werden. Langfristig sollen Unternehmen Gewinne maximieren, indem sie den Punkt suchen, an dem Grenzerlös und Grenzkosten übereinstimmen (MR=MC) [Springer Professional].
Doch diese Sichtweise greift zu kurz. Unternehmen agieren nicht im luftleeren Raum, sondern sind Teil eines gesellschaftlichen, politischen, sozialen, moralisch-ethischen und ökonomischen Gefüges. Die ausschließliche Fokussierung auf Gewinnmaximierung blendet Opportunitätskosten aus: Qualitätsverluste durch überzogene Sparmaßnahmen, psychischer Stress durch Überlastung, Innovationsstau durch Prozessfixierung1 und hohe Fluktuation durch mangelnde Mitarbeiterbindung sind reale Risiken, die in klassischen Gewinnformeln nicht auftauchen [Harvard Business Manager].
Hinzu kommt, dass die reine Gewinnmaximierung häufig zu einer kurzfristigen Denkweise verleitet. Unternehmen, die sich ausschließlich an Quartalszahlen und kurzfristigen Renditezielen ausrichten, vernachlässigen notwendige Investitionen in Forschung, Entwicklung und Weiterbildung. Die Folge: Die Innovationskraft sinkt, das Unternehmen wird anfälliger für Marktdisruptionen und verliert den Anschluss an technologische Entwicklungen. Gerade in Zeiten rasanten Wandels – Stichwort Digitalisierung – kann das fatale Folgen haben.
Ein weiterer blinder Fleck der Gewinnmaximierung ist die Vernachlässigung von Stakeholder-Interessen. Während Aktionäre kurzfristig profitieren mögen, geraten die Bedürfnisse von Mitarbeitenden, Kunden und auch der Gesellschaft ins Hintertreffen. Studien zeigen, dass Unternehmen mit einer starken Stakeholder-Orientierung langfristig erfolgreicher und resilienter sind [Harvard Business Review]. Nachhaltige Wertschöpfung entsteht nicht durch das Maximieren von Gewinnen um jeden Preis, sondern durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen Zielen.
Auch regulatorische und gesellschaftliche Entwicklungen setzen der reinen Gewinnmaximierung zunehmend Grenzen. Themen wie Corporate Social Responsibility (CSR)2, ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) und neue Berichtspflichten zwingen Unternehmen, über den Tellerrand der klassischen Gewinnformel hinauszublicken. Wer heute nur auf den schnellen Profit schielt, riskiert Reputationsschäden, rechtliche Konflikte und den Verlust gesellschaftlicher Akzeptanz [Handelsblatt].
Zusammengefasst: Die betriebswirtschaftliche Logik der Gewinnmaximierung ist zwar bestechend einfach – in der Realität aber zu eindimensional. Unternehmen, die ihre Rolle als gesellschaftliche Akteure ernst nehmen und ein ganzheitliches Verständnis von Wertschöpfung entwickeln, sind langfristig erfolgreicher und widerstandsfähiger gegenüber Krisen und Wandel.
2. Kostenminimierung als logische Folge – und ihre Fallstricke
Die Reduktion von Kosten erscheint als logische Konsequenz des Gewinnmaximierungsprinzips. Doch die reine Kostenminimierung kann kontraproduktiv sein, wenn sie zu Lasten von Qualität, Innovationskraft oder Mitarbeiterzufriedenheit geht. Unternehmen, die nur noch Prozesse optimieren und Kosten senken, laufen Gefahr, ihre Substanz zu verlieren und langfristig an Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen [Die Zeit].
Ein oft übersehener Aspekt ist der Fokus auf Vorhersagbarkeit und Planbarkeit bis hin zum Micromanagement, der in vielen Unternehmen zu einer prozessualen Überbestimmung führt. Immer detailliertere Vorgaben, standardisierte Abläufe und eng getaktete Prozesse sollen Risiken minimieren und Effizienz steigern. Doch dieser Drang nach Kontrolle und (geschönten) Berichten erinnert in seiner Konsequenz an die Planwirtschaft der DDR, die wegen ihrer Starrheit und Bürokratie lange Zeit belächelt wurde [MDR]. Ironischerweise entstehen heute in modernen Unternehmen durch überbordende Prozessvorgaben ähnliche Probleme: mangelnde Flexibilität, Innovationshemmnisse und ein Verlust an Eigenverantwortung auf allen Ebenen [Geschichte-lernen.net].
Die Kehrseite dieser Entwicklung zeigt sich auch in den gesundheitlichen Folgen für die Belegschaft. Statistiken der Krankenkassen belegen seit Jahren einen deutlichen Anstieg psychisch bedingter Krankmeldungen. Burnout, aber auch Boreout – also Unterforderung und Sinnverlust durch monotone, eng getaktete Arbeit – nehmen messbar zu [TK Psychoreport 2023]. So stiegen laut Techniker Krankenkasse die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen in den letzten Jahren kontinuierlich an. Auch der Anteil von Burnout-Diagnosen hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Boreout, das Pendant zur Überforderung, ist zwar schwerer zu erfassen, wird aber von Arbeitspsychologen als zunehmendes Problem in hochstandardisierten Arbeitsumgebungen beschrieben [Die Zeit].
Die Folge: Steigende Krankenstände, sinkende Produktivität und eine wachsende Entfremdung vom Unternehmen. Wer Prozesse und Kosten zum alleinigen Maßstab macht, riskiert nicht nur wirtschaftliche, sondern auch menschliche Kollateralschäden.
3. Die KPI-Falle: Was wird gemessen, was zählt wirklich?
In der Praxis werden zahlreiche KPIs (Key Performance Indicators) zur Steuerung herangezogen. Im Finanzbereich dominieren Kennzahlen wie Nettogewinnmarge, EBIT-Marge, Gesamtkapitalrendite oder Eigenkapitalrendite. Auch operative Kennzahlen wie Customer Lifetime Value, Kundenakquisitionskosten oder Bruttogewinnmarge stehen im Fokus.
| KPI | Bedeutung | Typische Gewichtung |
|---|---|---|
| Nettogewinnmarge | Profitabilität nach allen Kosten | Hoch |
| EBIT-Marge | Operative Ertragskraft | Hoch |
| Gesamtkapitalrendite | Verzinsung des eingesetzten Kapitals | Mittel bis hoch |
| Kundenakquisitionskosten | Effizienz der Neukundengewinnung | Mittel |
| Mitarbeiterzufriedenheit | Bindung und Motivation der Belegschaft | Gering bis steigend |
Auffällig: Mitarbeiterzufriedenheit und Innovationskraft werden selten als zentrale KPIs gewichtet – obwohl sie entscheidend für nachhaltigen Unternehmenserfolg sind [Harvard Business Review].
4. Folgen wir einem Mantra – oder nur den Erwartungen des Aktienmarktes?
Die Dominanz der Gewinnmaximierung ist eng mit den Mechanismen des Kapitalmarkts verknüpft. Shareholder Value und kurzfristige Kurssteigerungen prägen die Unternehmensführung vieler börsennotierter Unternehmen. Doch diese Ausrichtung spiegelt nicht zwingend die Interessen der Unternehmen selbst wider, sondern oft nur die Erwartungen von Investoren und Analysten. Die Gefahr: Unternehmen werden zu Getriebenen eines externen Narrativs, das ihre eigentliche Wertschöpfung und gesellschaftliche Verantwortung aus dem Blick verliert [NZZ].
Dieses Phänomen ist besonders in den USA, aber zunehmend auch in Europa zu beobachten: Unternehmenslenker sehen sich unter dem Druck, kurzfristig beeindruckende Zahlen zu liefern, um die Erwartungen der Finanzmärkte zu erfüllen. Investitionen in Innovation, Nachhaltigkeit oder Mitarbeiterentwicklung werden häufig dem Rotstift geopfert, wenn sie nicht unmittelbar den Aktienkurs befeuern. Der Zeithorizont der Unternehmensführung schrumpft auf das nächste Quartal, anstatt auf nachhaltige Wertschöpfung zu setzen [Harvard Business Review].
Die Folgen sind vielfältig: Unternehmen verlieren ihre strategische Unabhängigkeit, weil sie sich immer stärker an externen Erwartungen orientieren. Die eigentliche Mission, innovative Produkte zu entwickeln, gesellschaftlichen Nutzen zu stiften oder Arbeitsplätze zu sichern, tritt in den Hintergrund. Stattdessen dominiert ein kurzfristiges Denken, das langfristige Risiken – etwa Reputationsverluste, Innovationsstau oder den Verlust von Talenten – billigend in Kauf nimmt [FAZ].
Hinzu kommt, dass die Orientierung am Aktienmarkt nicht zwangsläufig die Interessen aller Stakeholder widerspiegelt. Während institutionelle Investoren und Analysten auf schnelle Renditen aus sind, wünschen sich Kunden, Mitarbeitende und die Gesellschaft häufig Stabilität, Qualität und verantwortungsvolles Handeln [Handelsblatt]. Diese Diskrepanz führt zu wachsender Kritik am Shareholder-Value-Prinzip und zur Forderung nach einer stärkeren Stakeholder-Orientierung.
Immer mehr Studien und Praxisbeispiele zeigen: Unternehmen, die langfristig denken, in ihre Belegschaft investieren und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, sind auch ökonomisch erfolgreicher und widerstandsfähiger gegenüber Krisen [Harvard Business Review]. Es ist an der Zeit, das Mantra der Gewinnmaximierung kritisch zu hinterfragen und Unternehmensführung wieder als gesellschaftliche Aufgabe zu begreifen – jenseits kurzfristiger Börsenlogik.
5. Wann ging es der Wirtschaft (und den Unternehmen) wirklich gut?
Historisch betrachtet waren es oft jene Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Teilhabe und Wertschätzung zugestanden, die langfristig erfolgreich waren. Ein moderates Gewinnplus bei hoher Mitarbeiterzufriedenheit erwies sich als nachhaltiger als kurzfristige Gewinnsprünge auf Kosten der Belegschaft. Die Fixierung auf Shareholder Value ist ein relativ junges Phänomen – und nicht zwingend ein Erfolgsmodell für die Zukunft [FAZ].
Ein entscheidender Erfolgsfaktor dieser Unternehmen war die Verantwortungsübernahme durch die Mitarbeitenden. Wenn Verantwortung auf allen Ebenen verteilt wird, profitieren nicht nur die Menschen selbst – sie erleben Sinn, Wertschätzung und Entwicklungsmöglichkeiten –, sondern auch das Unternehmen als Ganzes. Das Mitdenken und die Eigeninitiative der Mitarbeitenden ermöglichen es, das vorhandene Expertenwissen optimal zu nutzen. Entscheidungen werden näher an den tatsächlichen Herausforderungen getroffen, Probleme schneller erkannt und innovative Lösungen entwickelt.
Heute hingegen beobachten wir vielerorts eine Verlagerung der Verantwortung nach oben. Prozesse und Vorgaben werden immer detaillierter, Entscheidungsbefugnisse zentralisiert. Die „Wisdom of the Crowd“, also das kollektive Erfahrungswissen und die Kreativität der Belegschaft, bleibt dadurch ungenutzt. Durch Überregulierung und Prozessfixierung werden Eigeninitiativen erstickt3 – Mitarbeitende fühlen sich entmündigt und ziehen sich zurück [Haufe].
Diese Entwicklung ist nicht nur aus menschlicher Sicht problematisch, sondern auch ökonomisch kurzsichtig. Studien zeigen, dass Unternehmen, die auf Mitdenken und Eigenverantwortung setzen, innovativer, agiler und erfolgreicher sind. Die kollektive Intelligenz der Organisation bleibt jedoch auf der Strecke, wenn Prozesse alles bestimmen und Verantwortung nur noch bei der Führung liegt [Harvard Business Review].
Die Lehre aus der Geschichte ist eindeutig: Wirtschaftlicher Erfolg ist kein Nullsummenspiel. Unternehmen, die auf Teilhabe, Wertschätzung, Verantwortung und nachhaltige Entwicklung setzen, profitieren nicht nur selbst, sondern stärken auch das gesellschaftliche Vertrauen in die Wirtschaft. Es ist an der Zeit, diese Erkenntnisse wieder stärker in den Mittelpunkt unternehmerischen Handelns zu rücken.
6. Opportunitätskosten und die blinden Flecken der Gewinnmaximierung
Die klassische Gewinnformel berücksichtigt nicht:
- Qualitätsmängel durch überzogene Sparmaßnahmen
- Psychische Belastung und Burnout durch Über- oder Unterforderung
- Innovationsverlust durch Prozessfixierung und fehlende Freiräume
- Fluktuation durch fehlende Bindung und Identifikation
Diese Faktoren verursachen langfristig Kosten, die in keiner kurzfristigen Gewinnformel auftauchen, aber den Unternehmenserfolg massiv beeinträchtigen [BCG].
All dies sind Beispiele für Opportunitätskosten im betrieblichen Alltag: Es handelt sich um den entgangenen Nutzen, der entsteht, wenn Unternehmen sich für kurzfristige Gewinnmaximierung und gegen alternative, oft nachhaltigere Handlungsoptionen entscheiden [Agicap]. Klassisch werden Opportunitätskosten in der Kostenrechnung meist nicht erfasst, da sie keine realen, sondern verzichtete oder entgangene Vorteile darstellen [Wikipedia].
Beispiele aus der Praxis zeigen, wie gravierend diese Opportunitätskosten sein können: Wird etwa an der Weiterbildung gespart, entgeht dem Unternehmen die Chance auf Qualifikationsgewinne und Innovationsvorsprung. Werden Mitarbeitende durch Überlastung demotiviert, verliert das Unternehmen Know-how und Produktivität. Und wenn Prozesse so starr gestaltet sind, dass Kreativität und Eigeninitiative erstickt werden, bleibt das Innovationspotenzial der Organisation ungenutzt [Lexware].
Opportunitätskosten entstehen also immer dann, wenn Ressourcen – Zeit, Kapital, Aufmerksamkeit – nicht optimal eingesetzt werden. Sie sind der „blinde Fleck“ der klassischen Gewinnmaximierung: Was kurzfristig als Einsparung erscheint, kann langfristig zu erheblichen Verlusten an Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Mitarbeiterbindung führen.
7. Digitalisierung als neues Narrativ – und die Chance auf einen Paradigmenwechsel
Wie in meinem Artikel „Narrativ Digitalisierung“ dargestellt, erleben wir aktuell einen Wandel der Unternehmensnarrative: Digitalisierung wird zum neuen Leitmotiv, das Effizienz, Innovation und Flexibilität verspricht. Doch auch hier droht die Gefahr, dass Digitalisierung lediglich als weiteres Mittel zur Gewinnmaximierung und Kostensenkung missverstanden wird – statt als Chance, Geschäftsmodelle, Arbeitskultur und Wertschöpfung neu zu denken.
Der Begriff Digitalisierung wird häufig als Allheilmittel präsentiert: Effizienz, Automatisierung, Echtzeit-Reporting und neue Geschäftsmodelle sollen Unternehmen fit für die Zukunft machen. Doch die Realität ist komplexer. Wie im Originalartikel beschrieben, ist Digitalisierung kein standardisierter Baukasten, sondern ein tiefgreifender, kontextabhängiger Veränderungsprozess. Wer Digitalisierung nur als Mittel zur Kostenreduktion und Gewinnmaximierung betrachtet, verschenkt das eigentliche Potenzial: Die Chance, Prozesse, Zusammenarbeit und Wertschöpfung grundlegend neu zu denken.
Ein häufiger Fehler besteht darin, Digitalisierung mit Rationalisierung gleichzusetzen. Projekte werden gestartet, um Personal einzusparen oder Prozesse zu beschleunigen – ohne Rücksicht auf die gewachsene Unternehmenskultur, Notwendigkeiten oder die tatsächlichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Die Folge: Akzeptanzprobleme, Überforderung und Frustration. Digitalisierung darf nicht zum Selbstzweck oder zur Belastung werden, sondern sollte gezielt dazu genutzt werden, Arbeit sinnvoller, transparenter und nachhaltiger zu gestalten.
Wahre digitale Transformation beginnt beim Prozess und nicht beim Tool. Es reicht nicht, analoge Probleme einfach digital abzubilden – vielmehr müssen Abläufe kritisch hinterfragt, vereinfacht und an die neuen Möglichkeiten angepasst werden. Nur so entstehen echte Effizienzgewinne, bessere Datenqualität und eine höhere Nutzerakzeptanz. Ebenso wichtig ist es, die Qualität der Arbeit und die Kompetenzen der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt zu stellen. Digitale Kompetenzen, Veränderungsbereitschaft und eine offene Kommunikationskultur sind die eigentlichen Erfolgsfaktoren.
Ein weiterer blinder Fleck vieler Digitalisierungsinitiativen ist die Versuchung, alles messbar zu machen. Dashboards, KPIs und automatisierte Berichte suggerieren Kontrolle, führen aber oft zu einer Überfrachtung mit Kennzahlen, die wenig Aussagekraft besitzen. Die Gefahr: Der Mensch gerät aus dem Blick, und informelles Wissen, Erfahrung und Intuition werden entwertet. Gerade in komplexen Umfeldern braucht es jedoch beides: datenbasierte Steuerung und Raum für nicht-messbare, kreative Aspekte.
Digitalisierung sollte daher als evolutionärer Prozess verstanden werden, der sich am individuellen Rhythmus und den Bedürfnissen der Organisation orientiert. Es braucht maßgeschneiderte Lösungen, die zur jeweiligen Unternehmenskultur passen – keine Standardrezepte von der Stange. Besonders wichtig: Die Mitarbeitenden frühzeitig einbinden, ihre Expertise nutzen und ihnen Gestaltungsspielräume lassen. Nur so wird Digitalisierung zum echten Fortschrittsmotor und nicht zum Frustfaktor.
Auch regulatorische Anforderungen und Standards können als Katalysator für Digitalisierung wirken – vorausgesetzt, sie werden nicht als reine Belastung, sondern als Impuls für die Modernisierung der eigenen Prozesse verstanden. Ziel muss es sein, Synergien zu erkennen und Normen effizient umzusetzen, statt Doppelarbeit und Bürokratie zu fördern.
Am Ende bleibt: Digitalisierung ist kein Selbstzweck und kein reines Effizienzprojekt. Sie ist ein kultureller Wandel, der nur gelingt, wenn er von den Menschen im Unternehmen getragen und gestaltet wird. Unternehmen, die Digitalisierung als Chance für mehr Teilhabe, Innovation und nachhaltige Wertschöpfung begreifen, sind langfristig erfolgreicher – und sichern sich die Akzeptanz von Mitarbeitenden, Kunden und Gesellschaft gleichermaßen.
Fazit
Das Mantra der Gewinnmaximierung ist ein Relikt vergangener Jahrzehnte. Unternehmen, die sich ausschließlich daran orientieren, laufen Gefahr, ihre Innovationskraft, Mitarbeiterbindung und gesellschaftliche Akzeptanz zu verlieren. Die Fokussierung auf kurzfristige Gewinne blendet zentrale Erfolgsfaktoren wie Mitarbeiterzufriedenheit, nachhaltige Entwicklung und gesellschaftliche Verantwortung aus.
Die Herausforderungen der Gegenwart – von Digitalisierung über Fachkräftemangel bis hin zu gesellschaftlichen Erwartungen an nachhaltiges Wirtschaften – verlangen nach einem Paradigmenwechsel in der Unternehmensführung. Es ist an der Zeit, neue KPIs und Narrative zu etablieren, die nachhaltigen Erfolg, Teilhabe und Resilienz in den Mittelpunkt stellen. Dazu gehören:
- Langfristige Innovationsfähigkeit statt kurzfristiger Gewinnmaximierung
- Mitarbeiterbindung und -beteiligung als strategischer Erfolgsfaktor
- Gesellschaftliche Verantwortung und nachhaltige Geschäftsmodelle
- Flexibilität und Lernbereitschaft in einer sich wandelnden Welt
Unternehmen, die sich diesen Herausforderungen stellen und ihre Rolle als Teil eines größeren Ganzen begreifen, werden nicht nur wirtschaftlich erfolgreicher sein, sondern auch das Vertrauen von Mitarbeitenden, Kunden und Gesellschaft gewinnen. Es ist Zeit, das alte Mantra zu hinterfragen – und Platz zu machen für eine neue, ganzheitliche Form der Wertschöpfung.
Quellen & Lesetipps:
- Springer Professional: Gewinnmaximierung
- DeltaValue: Shareholder Value – Definition & Berechnung
- Frankfurt School Blog: Shareholder- vs. Stakeholder-Value-Ansatz
- Lexware: Shareholder Value Ansatz einfach erklärt
- Die Zeit: Arbeitsbedingungen und Arbeitsmarkt
- NZZ: Unternehmen zwischen Shareholder und Stakeholder Value
- FAZ: Warum Unternehmen von Mitarbeiterbeteiligung profitieren
- BCG: Employee Well-being and Business Performance
- TK Psychoreport 2023: Psychische Gesundheit und Arbeitswelt
- Gallup: State of the Global Workplace Report
- 42thinking.de: Narrativ Digitalisierung