Die sogenannte Trickle-down-Theorie – also die Idee, dass sich Wohlstand von oben nach unten „durchsickert“ – wirkt wie ein ökonomischer Witz. Doch der Sarkasmus, mit dem sie ursprünglich verbreitet wurde, ist vielen offenbar entgangen: Der Begriff wurde einst benutzt, um die absurde Logik der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik zu karikieren – nicht, um sie zu empfehlen.
Der Ursprung dieser Metapher lässt sich eindeutig auf den US-Humoristen Will Rogers zurückführen, der 1932 in einer Kolumne süffisant die Finanzpolitik der Regierung Hoover verspottete. Sein Vergleich lautete sinngemäß: Regierungsgelder werden an der Spitze konzentriert, in der Hoffnung, sie „rieselten“ zu den Armen herab – ähnlich wie Wasser, das auch entlegene Winkel erreicht. Doch Geld funktioniere nicht wie Wasser: Gäbe man es zuerst den Menschen unten, lande es ohnehin wieder bei den Vermögenden – aber es sei wenigstens einmal in Umlauf gewesen.
Auch später blieb die Idee Ziel scharfer Kritik. Ökonom John Kenneth Galbraith nannte sie spöttisch die horse and sparrow theory: „Wenn man dem Pferd genug Hafer gibt, bleibt für die Spatzen auf der Straße auch etwas übrig.“ Das deutsche Pendant: „Wenn das Pferd frisst, fallen dem Spatz Krümel ab.“ Die Botschaft: Von Überflussresten lässt sich keine gerechte Gesellschaft finanzieren – schon gar nicht in Zeiten wachsender Ungleichheit.
Ab den 1980er Jahren wurde die Logik dann politisch instrumentalisierbar. Ronald Reagan und Margaret Thatcher griffen sie auf, verpackten sie in das wohlklingende Vokabular der „angebotsorientierten Wirtschaftspolitik“ und machten sie zum Pfeiler neoliberaler Steuer- und Sozialmodelle. Die Ironie wurde zur ernsthaften Wirtschaftsdoktrin. Eine IWF-Studie von 2020 zeigt klar: Steuersenkungen für Reiche führen nicht zu mehr Beschäftigung oder starkem Wachstum – aber sehr wohl zu mehr Ungleichheit.

Heute wird der Begriff „Trickle-down“ oft gemieden, doch das Prinzip lebt weiter – in Forderungen nach Steuersenkungen für „Leistungsträger“, in der Rhetorik über „Wettbewerbsfähigkeit“ und „Wachstumsanreize“. Die ursprüngliche Pointe ist vergessen – geblieben ist ein ökonomisches Märchen mit großem Schaden.
Wenn Satire zur Staatsideologie wird
Im Kontext des Neoliberalismus, wurde die Trickle-down-Logik zur Glaubensregel. Eine einstige Karikatur wurde zur ökonomischen Staatsraison. Dahinter wirken drei ideologische Elemente zusammen:
- Adam Smiths „unsichtbare Hand“: Oft falsch interpretiert, denn Smith warnte selbst vor Machtkonzentration – von Trickle-down war bei ihm keine Rede.
- Ayn Rands radikale Marktethik: Ihre Welt war moralisch binär – Reiche verdienen ihr Glück, die Gesellschaft profitiert über Umwege.
- Das Mantra der Gewinnmaximierung: Wie im Artikel hier analysiert, wurde wirtschaftlicher Erfolg zum Maßstab aller Dinge – statt zum Mittel für Gemeinwohl.
In Deutschland halten Politiker wie Christian Lindner und Friedrich Merz die Idee unter neuem Etikett am Leben. Alles im Sinne des Marktes – und auf Kosten der Realität. Wie „Neoliberalismus am Scheideweg“ zeigt, verwischt diese Ideologie die Grenze zwischen Ökonomie und Glaube – mit weitreichenden Folgen für soziale Gerechtigkeit, Vertrauen in Institutionen und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Warum hält sich diese Theorie beharrlich?
- Der Ursprung als Ironie wurde vergessen: Was als Satire begann, wird heute als Sachpolitik verkauft.
- Sie ist einfach zu vermitteln: „Alle profitieren, wenn die Reichen profitieren“ – klingt bequem und marktkonform.
- Macht dient Macht: Die Profiteure verfügen über viel Geld, Einfluss und Medienmacht – sie können Narrative prägen.
- Sie ist ein Mythos – kein Modell: Ihre Wirkung liegt in der kulturellen Verankerung, nicht in der ökonomischen Beweisbarkeit.
- Sie ersetzt Debatte durch Alternativlosigkeit: Wer umverteilen will, wird schnell als „sozialistisch“ gebrandmarkt.
Fazit: Wenn Ironie ideologische Gewalt bekommt
Eine sarkastische Metapher wurde zur global wirksamen wirtschaftspolitischen Grundannahme. Die Trickle-down-Theorie ist deshalb weniger ein Denkfehler als ein Systemfehler. Dass sie trotz erdrückender Gegenbeweise überlebt, zeigt: Es geht nicht um Ökonomie – es geht um Macht, Deutungshoheit und politische Interessen.
Der wichtigste Schritt zur ökonomischen Emanzipation liegt daher nicht nur in neuen Modellen – sondern im Wiederentdecken des Zweifels. Vielleicht war das alles nie ernst gemeint. Vielleicht sollte man es endlich so behandeln.
Quellen und weiterführende Artikel
- Neoliberalismus am Scheideweg
- Liberalismus – Vision der Freiheit oder Pfad ins Chaos?
- Das Mantra der Gewinnmaximierung – Warum der Markt keine Moral kennt
- IWF Working Paper: Trickle-Down Economics Reconsidered (2020)
- Economic Policy Institute: Tax cuts and job growth – no empirical link
- The New Yorker: The Invisible Handwave – satirical origins of economic metaphors

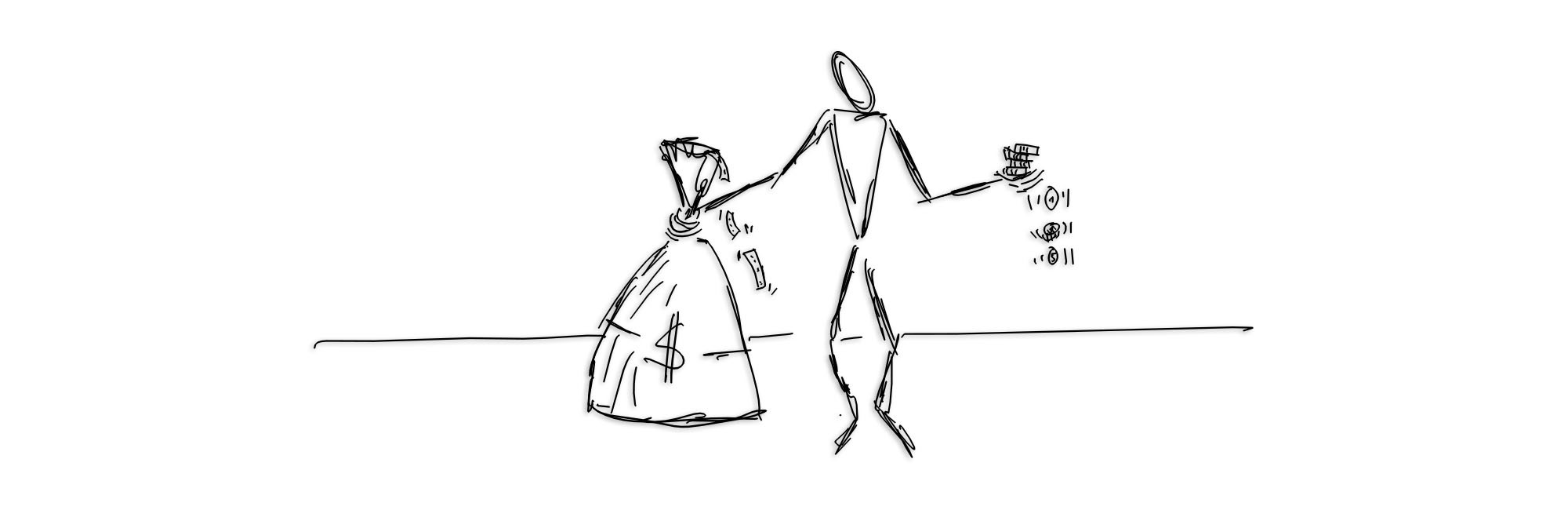
Guten Morgen, Ich frage mich gerade anhand des Beispiel mit dem Pferd-Hafer und Spatzen-Körner:
Leben – was ist das?
Was ist ein Leben als Pferd? oder als Spatz? oder eines als die Ameise?, die zwischen den fallenden Körnern noch ums Überleben laufen muß?
Das diese Theorie wirtschaftlich funktioniert, macht uns schnell die Realität offensichtlich:
Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln führen bei Geringverdienern zu Armut, zu Wohnungsverlust, usw.
Die Zahl der Räumungsklagen ua wegen Mietschulden ist seit 2020 jährlich um ca 10% gestiegen.
Die Frage ist, wie lange kann eine Gesellschaft mit solchen „Errungenschaften“ leben?
Ich möchte es mit einer Erkrankung wie Krebs vergleichen, rechtzeitig erkannt UND richtig behandelt, kann der Patient geheilt werden.
Falsch oder gar nicht behandelt stirbt der Patient zuerst- dann der Krebs…
Die Fragen sind berechtigt! Machen wir uns nichts vor, wir sind nur noch die Spatzen!
Jetzt ist es zwingend geboten, die Fehler aufzuzeigen:
ganz offensichtlich:
„Alle profitieren, wenn die Reichen profitieren“ -> Dieser Zusammenhang hat sich als FALSCH herausgestellt! Corona und die Maßnahmen dazu, hat viele in die Insolvenz getrieben.
Und „wir“ sind nicht die Spatzen, wir sind die Ameisen, ca 12 millionen… =Grundsicherungsempfänger.
Unsere Ausführungen passen zu dem Beitrag von Herrn Degenhardt bei LI, das Deutschland seine Millionäre verliert. 400 sollen ausgewandert sein…
Dass der Zusammenhang vom Trickle-Down-Ansatz völlig falsch ist, habe ich ja versucht darzustellen. Vielleicht ist es nicht deutlich genug herausgekommen.
Der Vergleich mit den Ameisen klingt niedlich, zeigt aber ganz nebenbei einen wichtigen Zusammenhang in der Ökologie auf – ohne Ameisen wäre das Ökosystem deutlich schlechter aufgestellt.
Das Thema Verlieren von Millionären sollte man sich vielleicht genauer anschauen. Die Amerikaner haben das recht pragmatisch gelöst – Staatsbürgerschaft = Steuerzahler, egal wo.