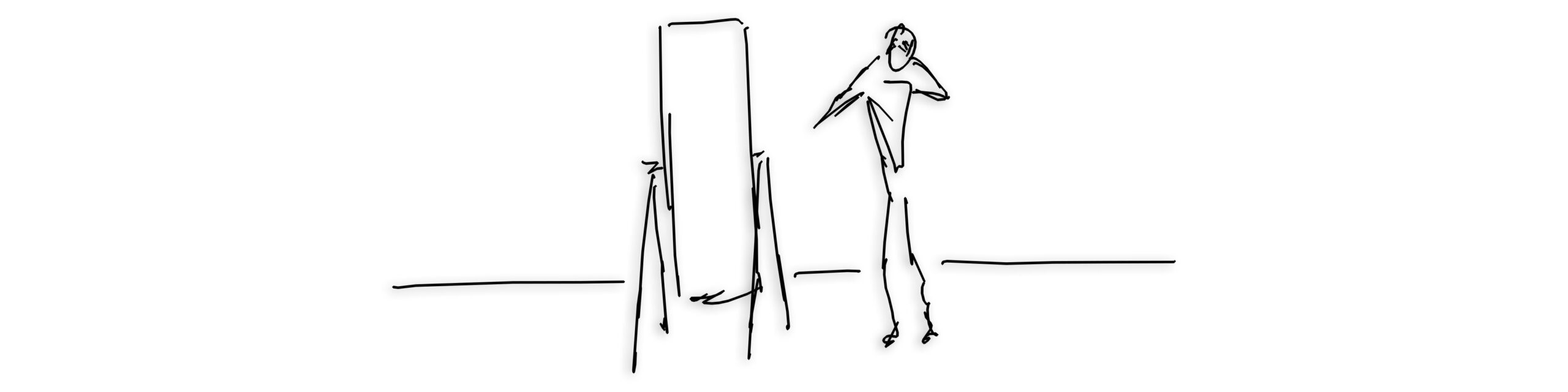Halluzinationen sind so alt wie das menschliche Bewusstsein – und doch gelten sie oft pauschal als Zeichen für eine gestörte Wahrnehmung. Was aber, wenn wir den Schleier der Pathologisierung lüften und tiefer blicken? Zwischen neurologischer Fehlfunktion, kulturellem Ritual und kreativem Ausnahmezustand liegt ein faszinierendes Spektrum, das weit mehr erzählt als die Geschichte vom „Defekt im System“.
Der reflexhafte Impuls, Halluzinationen medizinisch zu deuten, stammt aus einem Zeitalter, in dem die Trennung von Körper und Geist noch fest in der Wissenschaft verankert war. Wer Stimmen hörte, galt als krank. Wer Visionen hatte, als gefährlich. Doch die Geschichte der Menschheit ist durchzogen von Momenten, in denen genau solche Erfahrungen nicht nur akzeptiert, sondern gefeiert wurden. Visionäre galten als Seher, ekstatische Zustände als Eintritt in höhere Welten – ob bei den Orakeln von Delphi, im sufistischen Tanz oder im sibirischen Schamanismus.
Was also, wenn Halluzinationen nicht das Produkt eines Fehlers, sondern das Symptom einer anderen, vielleicht tieferen Form von Wirklichkeit sind – einer Realität, die nicht statisch ist, sondern mehrschichtig, fluide und subjektiv? Diese Perspektive lädt uns ein, Halluzinationen nicht vorschnell zu bewerten, sondern sie als Schnittstelle zu verstehen: zwischen Gehirn und Gesellschaft, Wahrnehmung und Bedeutung, Reiz und Sinnbildung.
In einer zunehmend durch Algorithmen strukturierten Welt, in der auch Maschinen beginnen, halluzinatorische Inhalte zu generieren, stellt sich die Frage erneut: Ist das „Falsche“ in Wahrheit nur eine andere Art, der Welt Sinn zu verleihen? Und brauchen wir vielleicht gerade jene Zustände, die außerhalb des Normalen liegen, um das Normale überhaupt zu erkennen – oder zu überschreiten?
Die klassische Perspektive: Fehlerhafte Rechenleistung im Hirn
Halluzinationen treten in verschiedenen psychischen und neurologischen Krankheitsbildern auf. Allen voran bei Schizophrenie, bipolaren Störungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen. Aber auch degenerative Erkrankungen wie Parkinson oder Lewy-Body-Demenz sind häufig begleitet von visuellen oder auditiven Halluzinationen.
Doch das Spektrum pathologischer Auslöser ist breiter: Auch pharmakologische Einflüsse wie das Parkinson-Medikament L-Dopa, klassische Halluzinogene (etwa LSD oder Psilocybin), Alkoholentzug und viele psychoaktive Substanzen können Wahrnehmungsstörungen auslösen. Oft genügt bereits eine extreme Veränderung der Sinneswahrnehmung – etwa durch sensorische Deprivation in Isolation, bei Dunkelheitsexperimenten oder auf langen Polarexpeditionen –, um das Gehirn in einen Zustand zu versetzen, in dem es beginnt, „Realität“ selbst zu generieren.
In diesen medizinisch-neurologischen Modellen erscheinen Halluzinationen als Störungen der neuronalen Informationsverarbeitung – gewissermaßen wie „defekte Pixel“ oder fehlerhafte Algorithmen in einer ansonsten funktionierenden Matrix. Das Gehirn sucht Sinn, wo kein Input mehr ist – oder filtert Reize nicht mehr korrekt, weil neurochemische Botenstoffe (etwa Dopamin oder Serotonin) aus dem Gleichgewicht geraten sind. So entsteht die paradoxe Erfahrung, dass sich die Grenze zwischen innen und außen – zwischen Vorstellung und Realität – verwischt.
Gleichzeitig zeigen gerade diese Zustände: Halluzinationen sind keine Ausnahme, sondern Ausdruck des enormen kreativen Potenzials des menschlichen Hirns, Sinn und Bedeutung auch dort zu finden, wo faktisch nichts zu entdecken wäre. Sie sind Symptome einer aus der Balance geratenen Wahrnehmung – aber womöglich auch ein Beweis für die Macht der subjektiven Welterzeugung, die uns als Spezies auszeichnet.
Neuronale Kurzschlüsse oder evolutionäre Superkraft?
Halluzinationen und Kreativität entspringen demselben neurokognitiven Ursprung: der Suche des Gehirns (bzw. KI-Systemen) nach Mustern und Bedeutung in Daten. Dieses Mustererkennungssystem kann zu Fehlinterpretationen führen – sogenannten Halluzinationen – oder aber zu originellen, innovativen Ideen und Lösungen, also Kreativität.
In der Evolution dient diese Fähigkeit als Überlebensvorteil durch erhöhte Aufmerksamkeit und Flexibilität im Denken. So kann das Gehirn potenzielle Gefahren oder Chancen frühzeitig erkennen – auch wenn manchmal fälschlich Muster wahrgenommen werden. Gleichzeitig ermöglicht dieser Prozess das Denken „außerhalb des Rahmens“ und fördert kulturelle und technische Innovationen.
Ähnlich zeigt sich diese Dualität bei Künstlicher Intelligenz: KI kann durch ihre Mustererkennung kreative Outputs erzeugen, aber auch „halluzinieren“, sprich plausible, aber falsche Informationen generieren. Das Verständnis dieser schmalen Grenze hilft, Risiken zu minimieren und kreative Potenziale gezielt zu nutzen, etwa in der Ideenfindung oder im Design.
Diese Erkenntnis lädt ein, Halluzinationen nicht nur als neurologischen Fehler zu betrachten, sondern als Teil eines komplexen Spektrums von Wahrnehmung und Bedeutungsschaffung, das evolutionär gewachsen und kreativ nutzbar ist – sowohl beim Menschen als auch bei Maschinen.
Quelle: Der Bogen von Kreativität und Halluzinationen – Patman.ai
Halluzinationen im Tierreich – mehr als Irrtum?
Studien zeigen, dass auch Tiere – von Delfinen bis zu Primaten – Verhalten zeigen, das auf halluzinatorische Erlebnisse hinweist. Ob durch sensorische Reizüberflutung, sozialen Stress oder die Einwirkung psychotroper Substanzen: Bewusstseinsveränderung scheint kein menschliches Alleinstellungsmerkmal zu sein, sondern ein tief verankerter Bestandteil biologischer Intelligenz.
Bei Tieren lassen sich solche Bewusstseinsphänomene nur indirekt erschließen – über abweichendes Verhalten, das sich nicht rein funktional erklären lässt: repetitive Bewegungen, scheinbare Interaktionen mit „unsichtbaren“ Objekten, Selbststimulation oder Fluchtreaktionen ohne äußeren Reiz. Besonders bei hochentwickelten Arten wie Menschenaffen, Oktopoden oder Delfinen mehren sich Hinweise darauf, dass sich das Gehirn unabhängig von externen Reizen eigene Erfahrungsräume erschließen kann – möglicherweise sogar halluzinatorische.
In kontrollierten Studien mit psychoaktiven Substanzen reagieren Tiere wie Fliegen, Spinnen, Katzen oder Elefanten teils sehr ähnlich wie Menschen: mit erhöhter Sensibilität, Hyperaktivität oder dezidiert veränderten Sinnesreaktionen. So wurde etwa bei Spinnen unter LSD-Einfluss eine signifikante Veränderung im Netzbau beobachtet, bei Katzen bekannte „Stimulantien“ wie Katzenminze oder Baldrian, die rauschähnliche Zustände auslösen (Nature 2020).
Was aber folgt daraus? Die Grenze zwischen „Realität“ und „Simulation“ ist offenbar keine statische, sondern eine neuronale Verhandlungssache. Halluzinationen sind – ob bei Mensch oder Tier – kein fehlerhafter Ausreißer, sondern scheinen das Resultat eines Gehirns zu sein, das nicht passiv reagiert, sondern aktiv Wirklichkeit konstruiert. Subjektive Realität ist kein Abbild, sondern ein emergenter Zustand – ein mentaler Raum, der ständig neu berechnet wird.
Diese Erkenntnis stellt unser Menschenbild infrage und rückt tierische Intelligenz in ein neues Licht. Wenn Tiere fähig sind, alternative Wirklichkeiten zu „sehen“ oder zu „erleben“, eröffnet das nicht nur neue Horizonte für Tierethik und Bewusstseinsforschung – sondern auch für unser eigenes Verständnis von Wirklichkeit. Vielleicht ist die Natur durchdrungen von inneren Realitäten, die wir bislang nur als Projektion des Menschen verstanden haben.
Frontiers: Altered States of Consciousness in Non-Human Animals
Nature 2020: Katzenminze und halluzinatorische Effekte bei Katzen
PMC Study: CNS effects of hallucinogens on animals
Wenn Maschinen träumen: Halluzinationen in der KI
Mit dem Aufstieg generativer KI bewegt sich auch die Technologie in halluzinatorische Gefilde. KI-Halluzinationen – ob durch Konfabulation, Factual Drift oder Mode Collapse – erzeugen Inhalte, die zwar plausibel, aber empirisch unhaltbar sind. Während klassische Software ein deterministisches System repräsentiert, betreten generative Modelle wie GPT damit eine semantische Grauzone zwischen Fakt, Fiktion und Fantasie.
Was in wissenschaftlichen oder juristischen Kontexten als bedrohliche Schwäche gewertet wird, kann in kreativen oder explorativen Domänen gerade zum Potenzial werden: Im Game Design, der Konzeptentwicklung, im Storytelling oder im Brainstorming kann ein künstliches System, das „halluziniert“, unerwartete Assoziationen erzeugen und so menschliche Innovationsprozesse inspirieren. Statt Fehler also: absichtlich generierte Realitätsfragmente als Ausgangspunkt für kreatives Denken.
Doch genau in dieser „programmierbaren Unschärfe“ liegt auch eine Gefahr: Sobald Halluzinationen nicht mehr als solche erkennbar sind, droht ein Erosionsprozess des Vertrauens. Informationssysteme, die wahllos zwischen Fakten und Fantasie wechseln, erzeugen kognitive Dissonanz – besonders wenn ihre Ausgaben von Nutzerinnen und Nutzern als autoritative Aussage missverstanden werden. Gerade im Bildungskontext, in Journalismus oder Medizintechnik wird damit eine Grenze sichtbar, die ethisch und technologisch nicht beliebig verschiebbar ist.
Die Diskussion erinnert an ein uraltes Dilemma: Ist Wissen nur dann wertvoll, wenn es wahr ist? Oder liegt in halbwahren, erfundenen oder imaginierten Inhalten ein Wert, der weit über Fakten hinausgeht – etwa in der Fähigkeit, neue Hypothesen zu generieren oder verborgene Zusammenhänge zu erkennen, bevor sie messbar sind? Manche KI-Modelle könnten also nicht nur als Antwortgeneratoren, sondern als kontrollierte Halluzinatoren genutzt werden – sozusagen als Maschinen für bewusst eingesetzte „produktive Missverständnisse“.
Was es dafür braucht: Klar deklarierte Betriebsmodi („Rekonstruktion vs. Imagination“), robuste Plausibilitätsfilter, transparente Prompt-Historien – und ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass auch Maschinen nur dann „wahr“ sind, wenn die Kontexte ihrer Aussage verständlich bleiben. In Zukunft könnten Halluzinationen weniger als Fehler gelten, sondern als Betriebsart – aber nur dann, wenn wir gelernt haben, ihre Illusion zu erkennen.
arXiv 2023: Multitask Evaluation of ChatGPT on Hallucination
MIT Technology Review: When AI Makes It Up
Nature: Hallucinating Artificial Intelligence
Kunst & Vision – Halluzination als schöpferischer Zustand
In Literatur, Malerei und Musik ist der halluzinative Zustand nicht Randphänomen, sondern oft Quelle der Genialität. Ob William Blake, Yayoi Kusama oder Aphex Twin – wahrnehmungsveränderte Zustände gebaren Meisterwerke, die sich der klassischen Logik verweigern. Oft ging der Inspiration ein körperlicher wie psychischer Ausnahmezustand voraus – gewollt oder erlitten. Die Grenzen zwischen innerer Vision und äußerer Wahrheit verschwimmen, wenn schöpferisches Denken nicht aus dem rationalen Kontrollzentrum, sondern tief aus dem Unbewussten gespeist wird.
William Blake sah seine Kunst als transzendente Offenbarung. Der Dichter und Maler berichtete von Engeln und mystischen Gestalten, die ihm erschienen – Erlebnisse, die seine Werke wie The Marriage of Heaven and Hell prägten. Für Blake war das nicht Wahnsinn, sondern Erkenntnis: eine Kunst, die das Sichtbare durch das Unsichtbare ergänzt.
Yayoi Kusamas Werke wiederum entstehen aus einem lebenslangen Ringen mit halluzinatorischer Wahrnehmung. Die japanische Künstlerin beschreibt ihre Punktmuster und endlosen Spiegelräume als Versuch, ihrer visuellen Überflutung Form zu geben. In diesem Spannungsfeld zwischen innerem Chaos und äußerer Struktur wird Halluzination zur ästhetischen Grammatik.
Auch in der Musik zeigt sich dieses Phänomen: Der elektronische Musiker Aphex Twin beschreibt seine Kompositionen als „organisch entstanden“ aus hypnagogischen Zuständen zwischen Wachen und Schlafen. Seine Klanglandschaften erinnern an Träume, an fehlerhafte Erinnerungen, an realitätsentfernte, aber emotional dichte Räume. KI-generierte Musik zitiert heute mitunter diesen Stil – ein Echo halluzinatorischer Ästhetik in maschinellem Kontext.
Interessanterweise galt diese Verbindung von Kunst und Halluzination kulturell lange nicht als Störung, sondern als Zugang zu einer höheren Wahrheit. Ob in der mystischen Dichtung des Mittelalters oder in romantischen Chiffren wie „Wahnsinn der Musen“ – immer wieder wurde der kreative Augenblick als Moment innerer Erkenntnis gesehen. Ein Ausnahmezustand vielleicht, aber einer mit Sinn.
Diese Tradition lebt fort: von psychedelisch inspirierter Malerei über surrealistische Literatur bis hin zu VR-Erfahrungen, die halluzinatorische Mechanismen bewusst nachbilden. In der Kunst darf die Welt nicht nur sein, wie sie ist – sie darf auch werden, was sie nie war. Und manchmal entsteht im Kontrollverlust jenes Neue, das keinen anderen Weg findet.
Tate – William Blake
Guggenheim – Yayoi Kusama
Pitchfork – Aphex Twin über Klang und Bewusstsein
Induzierung auf Rezept: Pilze, Kräuter, Reize
Halluzinationen lassen sich gezielt hervorrufen – sei es durch psilocybinhaltige Pilze, DMT-haltige Ayahuasca, oder einfache visuelle Stimulation wie flackerndes Licht. Solche Erfahrungen berichten von intensiven Farben, fremdsprachlich wirkenden Stimmen oder archetypischen Bildern – Erlebnisse, die häufig als transzendente Höhepunkte verstanden werden.
Was nach Eskapismus klingt, folgt oft strengen Mustern: In indigenen Kulturen bilden diese Zustände die Basis spiritueller oder heilender Rituale, etwa mit Ayahuasca im Amazonasraum oder Iboga in Westafrika. Die Halluzination wird hier nicht als Kontrollverlust verstanden, sondern als kommunikatives Medium zwischen Individuum und Kosmos, zwischen Ich und Ahnenwelt. Auch in modernen psychotherapeutischen Studien werden psychedelische Substanzen zunehmend als Werkzeuge zur Traumabewältigung erforscht – gerade weil sie neue Erlebnisräume öffnen, die kognitive Muster durchbrechen.
Doch nicht nur Substanzen können Halluzinationen hervorbringen: Auch intensive Reizmuster – etwa rhythmisches Blinken, binaurale Beats oder tieffrequente visuelle Stimuli – können visuelle oder akustische Halluzinationen induzieren. Studien zeigen, dass bereits ein regelmäßiges Starren auf flackerndes Licht bestimmte Hirnregionen zur Produktion komplexer Halluzinationsmuster animieren kann. Auch sogenannte „ganzkörperliche Vestibularreize“ – etwa durch langes Schweben oder Rotation – setzen das vestibuläre Gleichgewicht außer Kraft, wodurch das Gehirn anfängt, fremde Raumerfahrungen zu konstruieren.
In einer Kultur der Hyperrationalität erscheint dies paradox: Warum sollten Menschen bewusst Zustände aufsuchen, in denen das Gehirn die Realität „verliert“? Doch gerade diese temporäre Auflösung des Selbst kann als Neuverhandlung innerer Ordnung verstanden werden – als Reset der Wahrnehmung und der Ich-Grenzen. Die induzierte Halluzination wird zur mentalen Architekturkritik – ein radikaler Blick hinter die Projektionsflächen des Bewusstseins.
Journal of Psychopharmacology: Controlled psychedelics and trauma therapy
Frontiers in Neuroscience: Visual hallucinations and flicker-induced models
Nature Neuroscience 2023 – DMT and altered brain dynamics
Ritual & Offenbarung – Halluzination als spirituelle Technik
In vielen Kulturen sind Halluzinationen nicht pathologisches Symptom, sondern spirituelle Technik – bewusst hervorgerufen, gesellschaftlich eingebettet und sinnbildend. Im südamerikanischen Schamanismus etwa dienen Pflanzensubstanzen wie Ayahuasca nicht dem Rausch, sondern der Kommunikation mit Ahnen, Naturgeistern oder dem eigenen Unterbewusstsein. Der Trancezustand ist kein Kontrollverlust, sondern ein initiierter Übergang in eine andere Wirklichkeit, geführt von ritualisierten Rahmenbedingungen und kollektivem Verständnis.
Auch im Kontext buddhistischer Meditation gelten visuelle oder akustische Phänomene – etwa „Lichtblitze“, diffuse Formen oder Stimmen – nicht zwingend als Störung der Wahrnehmung. Vielmehr werden sie als Zeichen tiefer Bewusstseinsveränderung interpretiert. Die tibetische Praxis des „Thödol“ (auch bekannt als Tibetisches Totenbuch) betrachtet visionäre Bilder als projektionshafte Erfahrungsräume, die während des Sterbens erscheinen und spirituell relevant sind.
In der Geschichte der Hexerei und Seherei spielten Halluzinationen ebenfalls eine zentrale Rolle. Im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa wurden halluzinatorische Erfahrungen mit vermeintlicher Magie, Teufelsbuhlschaft und okkulten Fähigkeiten verknüpft. So wurden Hexen oft beschuldigt, mittels sogenannter „Hexensalben“ oder Flugsalben in halluzinatorische Trancezustände zu gelangen, die ihnen das Fliegen zu mystischen Sabbaten ermöglichen sollten. Diese Salben enthielten oft psychoaktive Pflanzenstoffe wie Bilsenkraut oder Nachtschattengewächse, die Halluzinationen und veränderte Bewusstseinszustände hervorrufen konnten.
Die berühmten Hexenprozesse von Salem im 17. Jahrhundert illustrieren die fatale Verknüpfung von Halluzinationen mit gesellschaftlichen Ängsten: Mädchen und Frauen litten unter unerklärlichen Anfällen und Visionen, die als „Besessenheit“ und teuflischer Einfluss interpretiert wurden. Diese halluzinatorischen Symptome führten zu Massenhysterie, Anklagen und brutalen Verfolgungen. Halluzinationen waren hier nicht nur individuell, sondern auch kollektiv als Ausdruck sozialer und kultureller Dynamiken wirksam.
Diese historische Perspektive zeigt, wie Halluzinationen als Schnittstelle zwischen Gehirn, Kultur und Macht fungieren können – mal als spirituelle Erfahrung, mal als Vorwand für Unterdrückung. Im Kontext von Hexerei und Seherei symbolisieren sie die enge Verknüpfung von Wahrnehmung, Glauben und gesellschaftlichen Deutungsmustern.
Deutschlandfunk: Hexenprozesse von Salem und Halluzinationen
Wikipedia: Hexenprozesse von Salem
Wikipedia: Hexensalbe und Halluzinationen
RP Online: Geschichte der Walpurgisnacht und Halluzination
Zwischen Schutzinstinkt und Selbstbestimmung: Die Angst der Nüchternen
Die gesellschaftliche Bewertung von Halluzinationen und halluzinogenen Substanzen ist stark von einer nüchtern-rationalen Haltung geprägt, die psychische und körperliche Gesundheit als zentrale Schutzgüter betrachtet. Daraus resultiert ein präventiver, oft auch restriktiver Umgang mit Drogen: Angst vor Kontrollverlust, psychischen Störungen und körperlichen Risiken prägt den öffentlichen Diskurs ebenso wie die Gesetzgebung.
Halluzinogene wie LSD, Psilocybin oder DMT rufen nicht nur Bewusstseinsveränderungen hervor, sondern können auch intensive Angstzustände, Desorientierung oder sogar bleibende Wahrnehmungsstörungen verursachen („Bad Trips“, Flashbacks, Depersonalisation). Für Menschen mit psychischer Vorbelastung besteht ein erhöhtes Risiko, latente Störungen auszulösen oder zu verstärken. Auch das Unfallrisiko steigt bei veränderter Wahrnehmung, was präventive Maßnahmen aus gesellschaftlicher Sicht nachvollziehbar macht.
Gleichzeitig stehen solche Schutzmaßnahmen immer im Spannungsfeld mit der individuellen Freiheit: Viele Menschen sehen in der bewussten Veränderung ihres Bewusstseins einen Akt der Selbstbestimmung, tief verbunden mit persönlicher Entwicklung, spiritueller Suche oder kreativer Entfaltung. Forscherinnen und Forscher entdecken zudem vermehrt das psychedelische Potenzial als Therapieansatz – etwa zur Behandlung von Depressionen oder Angsterkrankungen.
Der gesellschaftliche Umgang mit Halluzinationen und ihren Auslösern ist daher Ausdruck einer grundlegenden Abwägung: Wie viel Schutz vor Risiken ist nötig und gerechtfertigt – und wie viel Freiheitsraum für individuelle Erfahrungen, Erkenntnis und Transformation darf, ja muss gewährt werden? Die Antwort darauf ist ebenso kulturell wie politisch – und bleibt ein Spiegel der inneren Spannung zwischen Angst und Sehnsucht in der nüchtern-rationalen Moderne.
Fazit: Halluzination – Störung, Simulation oder Sinn?
Halluzinationen erscheinen im Schnittpunkt von Biologie, Kultur, Kunst und Technik. Als Fehler verurteilt, als Bedürfnis missverstanden, als Inspiration kultiviert. Vielleicht ist nicht die Halluzination der Irrtum – sondern unsere Vorstellung von Wirklichkeit. Wer, wenn nicht das Gehirn, hätte die Macht, seine eigene Realität zu schreiben? Und was könnte produktiver sein als ein temporärer Kontrollverlust, der uns bisher Undenkbares denken lässt?
Denn was wir heute als „Halluzination“ klassifizieren, ist historisch betrachtet oft Quelle von Erkenntnis, Mythos oder Innovation gewesen. Kulturübergreifend begegnen wir ihr in Schöpfungsmythen, Prophezeiungen, spirituellen Trancen oder radikal neuer Kunst. Sie ist das fremde Kind im Haus des Kartenverstands – unbequem, subversiv, aber auch: kreativ, disruptiv, sinnvoll. In einer Zeit globaler Krisen und festgefahrener Denkstrukturen könnten gerade solche „Illusionen“ helfen, festgefügte Weltbilder zu dekonstruieren und Alternativen erfahrbar zu machen.
An der Schnittstelle von Neurowissenschaft, KI-Forschung, Ritualkultur und Design entsteht ein neues Verständnis: Halluzination nicht als Ausnahme, sondern als mögliche Funktion – ein Filter, ein Spiegel, ein Generator. In der Zukunft wird möglicherweise nicht mehr gefragt: „Ist das real?“, sondern: „Welche Realität ist gerade wirksam – und für wen?“
Das Verstehen und Einordnen von Halluzinationen – sei es im menschlichen Gehirn, in der subjektiven Erzählung oder in der maschinellen Textgenerierung – erfordert eine besondere Form kognitiver Kreativität: die Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten, Bedeutungen in scheinbar Sinnlosem zu erkennen und neue Muster zu interpretieren. Halluzinationen lassen sich nicht objektiv „richtig“ oder „falsch“ bewerten – ihr Wert offenbart sich oft erst im narrativen, ästhetischen oder visionären Umgang mit ihnen. Wer Halluzinationen wirklich versteht, braucht nicht nur Analyse – sondern auch Vorstellungskraft und Inspiration.
Damit wird deutlich: Das Interesse an Halluzinationen ist kein Rückfall in Mystik oder Irrationalität, sondern ein Schritt in ein komplexeres Realitätsverständnis. Eines, das Mehrdeutigkeiten, Zwischenräume und Subjektivität nicht ausschließt, sondern integriert. Und das erkennt: Der „Irrtum“ mag in der Halluzination liegen – oder in unserer Fixierung auf eine einzige Realität unter vielen möglichen.
Vielleicht braucht es also genau diesen kurzen Weg ins Verrücken, um das vermeintlich Feststehende neu zu sehen. Sei es durch neuronale Funktionsverschiebung, künstliche Generierung, spirituelle Erfahrung oder ästhetische Konstruktion: Die Halluzination könnte mehr sein als ein Aussetzer des Systems – sie könnte ein Fenster in eine andere Form von Sinnbildung sein.