„Brot und Spiele“ – dieser Ausdruck stammt vom römischen Dichter Juvenal um 100 nach Christus. Er kritisierte damit die Strategie der römischen Machthaber, das Volk durch Nahrung und Unterhaltung ruhigzustellen und von politischen Fragen abzulenken. Heute, fast 2000 Jahre später, ist der Gedanke aktueller denn je. Nur dass „Brot“ heute nicht mehr das einfach gebackene aus dem Ofen ist, sondern industriell verarbeitete Lebensmittel voller Zusatzstoffe. Und die „Spiele“ sind nicht mehr Wagenrennen im Circus Maximus, sondern Streaming-Marathons und endlose Fußballligen. Doch was steckt dahinter? Und welche Rolle spielen Werbung, Konsum und gesellschaftliche Dynamiken?
Industrienahrung: Die stille Macht der ultraverarbeiteten Produkte
Ein Großteil unserer modernen Ernährung besteht inzwischen aus hochverarbeiteten Lebensmitteln. Diese „Ultraprocessed Foods“ umfassen Fertiggerichte, Snacks, Softdrinks oder auch vermeintlich gesunde Cerealien. Sie zeichnen sich durch lange Zutatenlisten aus – darunter künstliche Aromen, Emulgatoren, Geschmacksverstärker und Zucker in vielfältigen Formen. Studien belegen inzwischen, dass diese Ernährungsweise mit Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes in Verbindung steht (BMJ-Studie).
Doch im Alltag fehlt oft die klare Warnung. Während auf Zigarettenschachteln Schockbilder kleben, wird für Chips, Burger oder Softdrinks nach wie vor mit bunten Spots und Glücksversprechen geworben. Animation, Popmusik, bunte Farben – die Werbebotschaften zielen auf Emotionen, nicht auf Aufklärung. So entsteht eine subtile gesellschaftliche Steuerung: Wer regelmäßig Produkte kauft, die kurzfristig Lust und Bequemlichkeit bedienen, ist leichter an Konsumzyklen gebunden. Gleichzeitig fehlt das Bewusstsein für die langfristigen Folgen.
Werden hier neue Märkte für die Gesundheitsindustrie geschaffen? Insulin, Antidepressiva, Herz-Kreislauf-Medikamente sind Milliardenmärkte, in deren Fahrwasser privatisierte Kliniken, Krankenkassen samt deren hochbezahlten Vorständen, dubiose Therapieversprechen und Quacksalber mitreisen?
Die Ästhetik der Ablenkung: Streaming, Serien und unbegrenzte Fußballligen
Das zweite große Feld im modernen „Brot-und-Spiele“-Komplex ist das Entertainment. Plattformen wie Netflix, Prime Video und Disney+ produzieren eine schier endlose Flut an Serien und Filmen. Das Prinzip: Immer neue Formate, Cliffhanger, automatische Wiedergabe. Während man früher ein oder zwei Abende in der Woche für Fernsehen reservierte, ist heute jederzeit Unterhaltung auf Knopfdruck verfügbar. Die Frage „Was machen wir heute?“ wird ersetzt durch „Welche Staffel schauen wir als nächstes?“.
Parallel dazu erleben wir eine Expansion neuer Fußballwettbewerbe: Ob Nations League, Supercups oder internationale Klubturniere – es wird nahezu durchgängig gespielt. Lange Pausen wie einst im Sommer verschwinden zunehmend. Fußball ist längst nicht mehr bloß Sport, sondern Dauerunterhaltung und vor allem ein gigantisches Geschäft. Sponsoren, Rechtevermarkter und Plattformen verdienen am permanenten Spektakel. Auch die Clubs und Spieler selber verdienen mittlerweile Unmengen, jenseits jedes Verhältnisses zu den „Normalsterblichen“.
Von Juvenal bis heute: Kontinuität der Strategie
Als Juvenal „Brot und Spiele“ schrieb, meinte er die bewusste Ablenkung des Volkes von Politik und Machtfragen. Die Menschen im Römischen Reich erhielten kostenloses Getreide und wurden mit opulenten Spielen beschäftigt. In unserer Zeit sind es Convenience-Food, Streaming-Serien und die endlose Verlängerung von Sportereignissen. Die Parallele liegt auf der Hand: Beschäftigung auf niedrigschwellige Art, einfache Befriedigung grundlegender Lustbedürfnisse – während kritisches Hinterfragen in den Hintergrund tritt.
Der entscheidende Punkt: Diese Mechanismen müssen nicht von einem unsichtbaren Drahtzieher gesteuert werden. Es ist kein geheimes Komplott notwendig. Vielmehr sind es die Dynamiken des Marktes, die „Zügel“ bilden. Werbung treibt die Nachfrage an, Nachfrage fördert die Produktion, Algorithmen verstärken Nutzungsmuster. Am Ende folgen wir einer Maschinerie, die niemandem allein gehört, aber von allen Akteuren – Unternehmen, Investoren, Medienhäusern – getragen wird.
Wer hält die Zügel?
Die spannende Frage ist also: Wer sind die „Zügelhalter“? Statt an eine große Verschwörung zu glauben, können wir schärfer auf die gesamtgesellschaftlichen Strukturen schauen:
- Unternehmen und Industrien: Lebensmittelkonzerne optimieren Produkte gezielt auf „Hyperpalatibilität“ – eine Kombination von Zucker, Salz und Fett, die unser Belohnungssystem maximal anspricht. Streamingdienste nutzen algorithmische Empfehlungen, um uns immer weiter konsumieren zu lassen. Fußballverbände und Fernsehanstalten schaffen mehr Formate, um Aufmerksamkeit monetarisieren zu können.
- Politik und Regulierung: Zwar gibt es vereinzelt Diskussionen, etwa um Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel in Kinderprogrammen (Tagesschau), aber bislang fehlen groß angelegte Maßnahmen. Anders als beim Tabak fehlt eine gesellschaftliche Klarheit, dass bestimmte Konsumformen gesundheitlich und sozial schädlich sind.
- Konsumenten selbst: Wir vergessen leicht, dass es auch unsere Entscheidungen sind, die diese Strukturen nähren. Bequemlichkeit, Gewohnheit und das Bedürfnis nach Ablenkung treiben uns in die Arme von Fast Food und Binge-Watching. Damit sind wir nicht einfach Opfer, sondern aktiver Teilhaber des Spiels.
Die Mechanismen der Steuerung
Interessant ist dabei die Parallele von Industrienahrung und Entertainment: Beide arbeiten mit ähnlichen psychologischen Tricks. Beim Essen sind es „Cravings“, also das Verlangen nach sofortiger Belohnung durch Zucker und Fett. Beim Streaming sind es Cliffhanger und Autoplay-Funktionen, die uns in Dauerschleifen halten. Beides kaum zufällig, sondern gezielte Nutzung menschlicher Schwächen. Das Ziel: höhere Konsumzahlen, mehr Umsatz, mehr Wachstum.
Die Illusion der Freiheit
Auf den ersten Blick leben wir in einer Gesellschaft grenzenloser Auswahl. Es gibt tausende Lebensmittel im Supermarkt, Millionen Serienfolgen auf den Plattformen, Dutzende Fußballwettbewerbe. Doch je genauer man hinschaut, desto stärker zeigt sich: Das „Mehr“ ist vor allem ein „Mehr vom Gleichen“. Fertiggerichte haben ähnliche Rezepturen. Serien ähneln sich in Dramaturgie und Erzählmustern. Fußballspiele laufen nach vergleichbarem Schema. Die Vielfalt ist eine Inszenierung, die uns das Gefühl von Freiheit gibt – ohne dass tatsächlich viel Neues entsteht.
Gesellschaftliche Folgen: Von Sattheit und Stillstand
Die römischen „Brot und Spiele“ führten nicht zu einer aktiven Bürgerschaft, sondern zu einem Volk, das auf Konsum eingestellt war. Auch heute entstehen daraus Konsequenzen: Gesundheitsschäden durch falsche Ernährung, Bewegungsmangel durch endloses Sitzen. Gleichzeitig eine Kultur, die überlastet ist durch Informationsüberfluss und permanente Ablenkung. Tiefere gesellschaftliche Debatten geraten in den Hintergrund, wenn das nächste Turnier oder die neue Serien-Staffel ansteht. Aber Spoiler: Rom ist untergegangen.
Wege aus der Spirale
Die gute Nachricht: Wie bei jedem gesellschaftlichen Mechanismus gibt es Handlungsspielräume. Sie liegen nicht nur in der Politik, sondern auch bei jedem Einzelnen:
- Bewusstsein schaffen: Aufklärung über die Folgen von ultraverarbeiteten Lebensmitteln und unreflektierter Mediennutzung ist zentral. Studienwissen muss stärker in den Alltag übersetzt werden.
- Regulierung anpassen: Eine strengere Werbungskontrolle, klare Kennzeichnungen und Bildungsinitiativen könnten langfristig einen Umschwung einleiten.
- Individuelle Verantwortung: Jeder kann Ess- und Mediengewohnheiten reflektieren. Selbst kleine Schritte wie öfter frisch kochen oder Streaming bewusst zu begrenzen, setzen Signale.
Fazit: Brot und Spiele im 21. Jahrhundert
Juvenals Analyse wirkt heute geradezu prophetisch. Brot und Spiele sind weniger verschwunden als transformiert. Aus Getreide wurde Industrienahrung, aus Wagenrennen globale Fußball-Events, aus Theaterstücken algorithmisch optimierte Serien. Die Frage bleibt dieselbe: Wollen wir uns durch bequeme Ablenkung steuern lassen – oder Verantwortung übernehmen und den Zügeln nicht nur folgen, sondern sie selbst in die Hand nehmen?

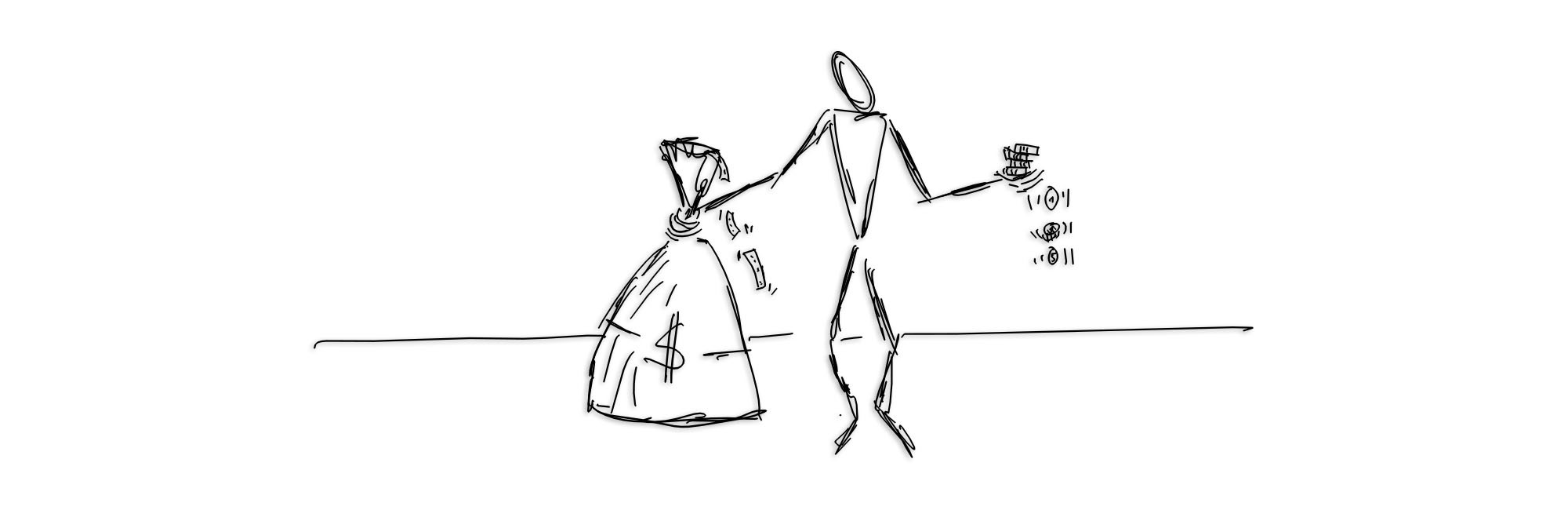
Hallo Andy,
bitte mal hier schauen: https://www.linkedin.com/in/martin-winkler-a1997029/
Link zur Grafik von Martin Winkler anzeigen
Martin WinklerMartin Winkler
• Follower:inPremium • Follower:in Gründer ADHSSpektrum | Community für ADHS & Neurodiversität | Ärztlicher Leiter Psychiatrie & Psychosomatik | ADHS-Coach | Buddy-Coaching, Hacks & Austausch auf SkoolGründer ADHSSpektrum | Community für ADHS & Neurodiversität | Ärztlicher Leiter Psychiatrie & Psychosomatik | ADHS-Coach | Buddy-Coaching, Hacks & Austausch auf Skool
Ihren Newsletter anzeigen
6 Std. • Bearbeitet •
vor 6 Stunden • Bearbeitet • Alle Mitglieder und Nicht-Mitglieder von LinkedIn
Gestern, am 13.9.2025 hatten wir im Sinnreich Wendland ein wunderbares Treffen zu Neurodivergenz. Das hat bei mir Gedanken zu „normalen Menschen“ ausgelöst, die ich mit Dir teilen möchte. Vielleicht markiert ihr ReferentInnen und Teilnehmer der Veranstaltung zum Netzwerken und im Kontakt bleiben?
Hashtag#adhs Hashtag#autismus Hashtag#neurodivergenz Hashtag#rumluebeln Hashtag#normal Hashtag#pda Hashtag#adhsspektrum
thema neurodiversität und die Frage nach „Normal“
Und ja mit dem ZEITKLAU wird uns einfach die Zeit und Möglichkeit, uns ein eigenes Urteil zu bilden!
In Aachen hing am Fenster der Verbindung gegenüber der Spruch: “ Vorurteile sind Fehlurteile“
… ist bis heute hängen geblieben!
und Vince Ebert hat zu deinem Thema noch einen tollen Beitrag bei LI gezeigt!
schönen Sonntag noch