Die fortschreitende Digitalisierung verspricht gesellschaftlichen Fortschritt und Effizienz, doch sie bringt auch eine Schattenseite mit sich: Diskriminierung auf verschiedenen Ebenen. Nicht jede Bevölkerungsgruppe profitiert gleichermaßen von digitalen Innovationen. Vielmehr entsteht eine Kluft zwischen denen, die Zugang, Fähigkeiten und Ressourcen besitzen, und denen, die ausgegrenzt werden. Die folgenden Aspekte zeigen, wie tiefgreifend und vielfältig diese Diskriminierung und somit Exklusion ist.
Digitalisierung für Programmierer, nicht für Nutzer
Digitalisierung wird oft aus der Perspektive von Entwicklern und Technikexperten konzipiert. Software und digitale Lösungen sind häufig für Programmierer gemacht, nicht für die breite Nutzerbasis. Dieses Missverhältnis führt dazu, dass digitale Angebote oft zu komplex und unintuitiv sind. Zwar gewinnen No-Code- und Low-Code-Plattformen an Bedeutung und öffnen die Welt der Automatisierung zunehmend auch für Nicht-Programmierer, doch das Gros der digitalen Produkte bleibt technisch dominiert, was Barrieren für Nutzer schafft, die keine IT-Profis sind. Das Ziel sollte eine nutzerzentrierte Digitalisierung sein, bei der Bedienbarkeit und Mehrwert für alle im Mittelpunkt stehen (Enpredo).
Digitalisierung für Technikaffine, nicht für Digital-Skeptiker
Die digitale Welt belohnt oft diejenigen mit Technikaffinität – Menschen, die neugierig sind, sich aktiv mit Technik auseinandersetzen und sie in ihren Alltag integrieren. Demgegenüber stehen Menschen, die digitale Technologien bewusst ablehnen oder sich von ihnen überfordert fühlen. Diese Gruppe benötigt einen positiven, wertschätzenden Begriff, etwa „Digital-Skeptiker“ oder „Technik-Kritiker“, um ihr legitimes Bedürfnis nach Datenschutz, digitaler Selbstbestimmung und analoger Wahlfreiheit anzuerkennen. Die Forderung nach einem Grundrecht auf ein analoges Leben unterstreicht, dass Nicht-Nutzung nicht gleichbedeutend mit Inkompetenz ist, sondern oft eine bewusste Entscheidung gegen Überwachung und Datenmissbrauch (BAGSO-Interview mit Heribert Prantl).
Digitalisierung für Akademiker, nicht für digital bildungsferne Gruppen
Der Zugang zu und der erfolgreiche Umgang mit digitalen Technologien korrelieren stark mit Bildungsstand. Digitalisierung bevorzugt jene mit akademischem Hintergrund, die systematisch digitale Kompetenzen vermittelt bekommen und Zugang zu Weiterbildung haben. Für digital bildungsferne Gruppen, die von Bildungsangeboten ausgeschlossen sind oder diese nicht wahrnehmen, ergeben sich oft die größten Hürden im digitalen Alltag. Dieser digitale Bildungsunterschied übersetzt sich in berufliche und gesellschaftliche Chancenungleichheit. Statt „lower-educated“ sollte von „digital bildungsfernen Gruppen“ gesprochen werden, um Stigmatisierung zu vermeiden und den Fokus auf systemische Barrieren zu lenken (Digitale Agenda).
Digitalisierung für Erfahrene, nicht für Einsteiger
Digitale Produkte setzen oft Vorerfahrungen voraus, die Einsteiger nicht mitbringen. Fehlende intuitive Benutzerführung, komplexe Interaktionen und die hohe Geschwindigkeit von Innovationszyklen erschweren Neulingen den Zugang. Besonders ältere Menschen oder Umsteiger aus analogen Bereichen benötigen barrierefreie, leicht verständliche Angebote und niedrigschwellige Lernformate, damit sie die digitale Welt nicht als Ausschluss erleben (Studie zur digitalen Exklusion im Alter).
Digitalisierung für Unversehrte, nicht für Menschen mit Einschränkungen
Viele digitale Anwendungen sind nicht ausreichend barrierefrei und damit für Blinde, Taube oder körperlich Eingeschränkte nur eingeschränkt nutzbar. Selbst „dicke Finger“ können bereits eine Behinderung darstellen! Barrierefreiheit braucht konsequente Umsetzung von Standards wie den WCAG, mehr Assistenztechnologien und Bewusstseinsbildung unter Entwicklern. Digitale Barrierefreiheit ist keine Kür, sondern Pflicht für inklusive Teilhabe (Landesbeauftragte Rheinland-Pfalz).
Digitalisierung als Vermögensfrage
Digitale Endgeräte, stabiler Internetzugang und technische Unterstützung sind teuer. Menschen mit geringem Einkommen fehlen oft die Voraussetzungen für digitale Teilhabe, was die soziale Spaltung verschärft. Diese finanzielle Hürde betrifft nicht nur die Technik an sich, sondern auch die Kosten für laufende Internetverbindungen und Lernangebote (StudySmarter).
Algorithmische Diskriminierung als digitale Verstärkung struktureller Ungleichheiten
Automatisierte Entscheidungssysteme (ADM) und Algorithmen sind nicht neutral. Sie können Vorurteile und Diskriminierungen aus den Daten übernehmen und verstärken. Beispiele zeigen, wie KI-basierte Bewerberauswahl oder Gesichtserkennung Minderheiten benachteiligen. Die Black-Box-Natur dieser Systeme erschwert Transparenz und Nachvollziehbarkeit, was den Schutz vor digitaler Diskriminierung erschwert (mebis Magazin, Antidiskriminierungsstelle Bundesrepublik).
Die Digitalisierung als narratives Konzept
Digitalisierung ist auch ein Narrativ – eine Erzählung, die mit Fortschritt, Innovation und Zukunftshoffnung verknüpft wird. Dieses Storytelling prägt, wie Technik wahrgenommen und eingesetzt wird, oft mit einem starken Fortschrittsglauben, der kritische Stimmen ausblendet. Narrative über „Digital Natives“ und „Digital Immigrants“ etablieren Wissen- und Fähigkeitshierarchien, die digitale Exklusion verstärken. Das Bewusstsein für Digitalisierung als kulturelles und soziales Konstrukt öffnet Raum, alternative, inklusive Erzählungen zu schaffen, die Vielfalt und unterschiedliche Zugänge anerkennen (Universität Koblenz, Narrative Ethik und Digitalisierung).
Digitalisierung für den Globalen Norden, nicht für den Globalen Süden
Die digitale Kluft verläuft nicht nur innerhalb einzelner Gesellschaften, sondern auch zwischen Weltregionen. Während der Globale Norden mit Hochgeschwindigkeitsinternet, flächendeckender Infrastruktur und starken Investitionen in Forschung und Entwicklung ausgestattet ist, fehlen im Globalen Süden häufig die Grundlagen. Länder ohne stabile Stromversorgung, mit schwacher Netzabdeckung und geringem Zugang zu Bildung können kaum an der digitalen Transformation teilhaben. Diese Ungleichheit hat geopolitische Folgen: Digitale Abhängigkeiten entstehen, Datenkolonialismus wird diskutiert, und digitale Souveränität bleibt für viele Staaten ein unerreichbares Ziel. Eine gerechte Digitalisierung muss deshalb auch globale Verantwortung und Fairness in den Blick nehmen.
Digitale Arbeitsteilung – Gewinner und Verlierer der Plattformökonomie
Mit der Digitalisierung verändert sich nicht nur der Alltag, sondern auch die Arbeitswelt. Plattformen wie Uber, Lieferando oder Amazon Mechanical Turk schaffen neue Erwerbsmöglichkeiten, führen jedoch auch zu prekären Arbeitsbedingungen. Digitale Arbeit ist oft flexibel, aber unsicher; sie verlagert Risiken auf die Beschäftigten und verstärkt globale Ungleichheiten, da viele Plattformjobs in Niedriglohnländern angesiedelt sind. Wer digitale Kompetenzen und Kapital besitzt, profitiert von neuen Märkten, während andere in schlecht bezahlte, fragmentierte Tätigkeiten gedrängt werden. Diese ungleiche Verteilung verdeutlicht, dass Digitalisierung nicht automatisch Wohlstand für alle schafft, sondern soziale Ungleichheiten neu strukturiert.
Digitalisierung für Mehrheiten, nicht für Minderheiten
Digitale Systeme sind häufig auf die Bedürfnisse einer „Durchschnittsbevölkerung“ zugeschnitten. Minderheiten – etwa sprachliche, kulturelle oder religiöse Gruppen – werden dabei kaum berücksichtigt. Sprachmodelle oder Übersetzungssoftware beherrschen dominante Weltsprachen, während kleinere Sprachgemeinschaften digital unsichtbar bleiben. Auch kulturelle Vielfalt findet in der digitalen Welt nur bedingt Platz: Viele Plattformen und Algorithmen spiegeln westliche Normen wider und marginalisieren abweichende Perspektiven. Dies verdeutlicht, dass digitale Exklusion nicht nur technisch, sondern auch kulturell bedingt ist.
Digitale Demokratie oder digitale Spaltung?
Die Digitalisierung von Politik und Verwaltung birgt große Chancen – etwa durch E-Government, digitale Partizipation oder Transparenzinitiativen. Gleichzeitig entsteht das Risiko einer „Zweiklassen-Demokratie“: Wer digital kompetent und gut ausgestattet ist, kann sich stärker einbringen, während andere von Teilhabe ausgeschlossen werden. Schon heute zeigt sich, dass Online-Petitionen, digitale Bürgersprechstunden oder smarte Verwaltungsdienste vor allem jene nutzen, die über hohe Medienkompetenz verfügen. Damit droht ein Demokratiedefizit: Digitalisierung stärkt nicht automatisch Partizipation, sondern kann politische Ungleichheiten sogar verschärfen.
Digitale Ethik als Schlüssel für Inklusion
Die beschriebenen Formen der digitalen Diskriminierung verdeutlichen, dass technologische Lösungen allein nicht ausreichen. Entscheidend ist die Frage nach Werten, Normen und Verantwortung. Digitale Ethik fordert, dass Technologien nicht nur funktional und effizient, sondern auch gerecht, transparent und inklusiv gestaltet werden. Dazu gehören Prinzipien wie „Privacy by Design“, die konsequente Berücksichtigung von Barrierefreiheit und der Anspruch, technologische Entwicklungen demokratisch zu kontrollieren. Digitale Ethik darf kein Nischenfeld bleiben, sondern muss Grundlage einer zukunftsfähigen Gesellschaft sein.
Fazit – Von der Technikzentrierung zur Menschzentrierung
Digitale Diskriminierung verläuft entlang verschiedener gesellschaftlicher Linien – Bildung, Alter, Behinderung, sozioökonomischem Status, globaler Herkunft, technischer Vorerfahrung und kultureller Zugehörigkeit. Für eine gerechte Zukunft muss Digitalisierung neu gedacht werden: weg von technologiezentrierten Produkten hin zu inklusiven, nutzerorientierten Lösungen, die Diversität respektieren und soziale Teilhabe fördern. Es braucht politische Regulierung, technische Standards und gesellschaftliche Debatten, um Exklusion zu verhindern und Teilhabe zu ermöglichen. Nur wenn Digitalisierung vom Menschen her gedacht wird, kann sie zu dem werden, was sie verspricht: ein Werkzeug für Fortschritt, Freiheit und soziale Gerechtigkeit.
Quellen und Verweise:
- NDR – Senioren fordern Recht auf analoges Leben
- Enpredo – Digitalisierung für Programmierer, nicht für Nutzer
- BAGSO – Interview mit Heribert Prantl
- Digitale Agenda – Digitale Spaltung
- PMC – Digitale Exklusion im Alter
- Landesbeauftragte Rheinland-Pfalz – Digitale Barrierefreiheit
- StudySmarter – Digitale Spaltung und soziale Ungleichheit
- mebis Magazin – Algorithmische Diskriminierung
- Antidiskriminierungsstelle – Diskriminierungsrisiken durch Algorithmen
- Universität Koblenz – Digitales Storytelling
- Narrative Ethik, Digitalisierung und Erwachsenenbildung

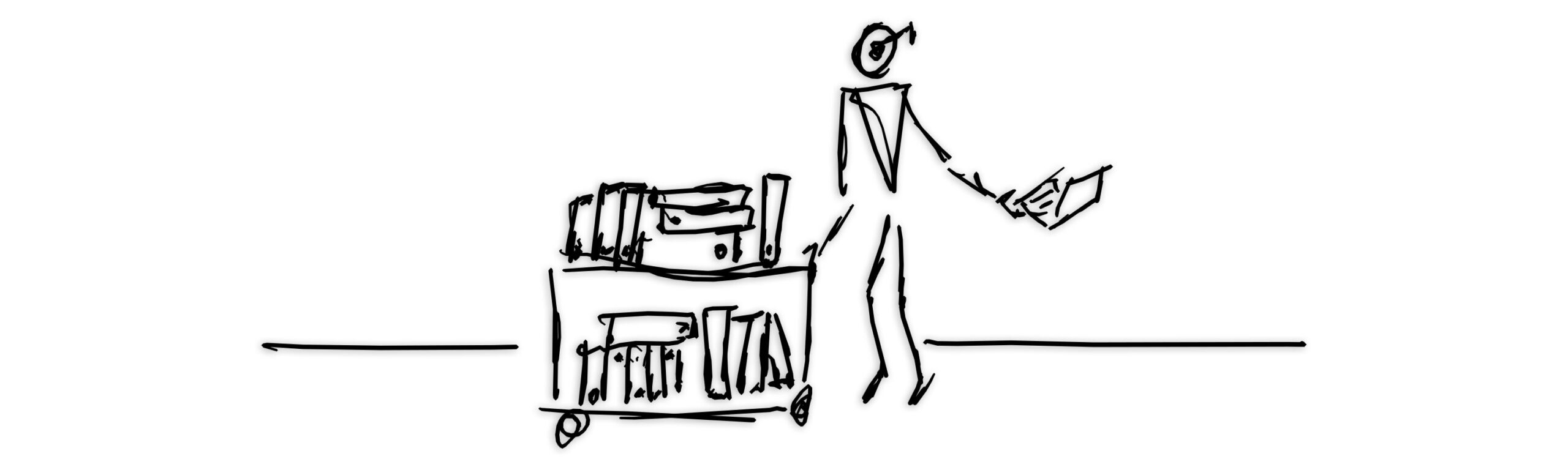
Guten Morgen und danke für Deinen Bei- oder besser Zusammentrag zum Thema Digitalisierung!
Während mein Bauchgefühl 1999 beim Internet von der Atombombe des nächsten Jahrhunderts sprach, waren meine Bedenken zu Digitalisierung und/oder der damit verbundenen KI vor 10 Jahren ebenso stark ausgeprägt!
Wenn Sarrazin in seinem Buch „Deutschand schafft sich ab“ von 2010 die Entwicklung der Völkerwanderung nach Deutschland analysiert und hochrechnet, in seiner Aktualisierung 2025 die Genauigkeit seiner Prognosen beschreibt, wird einem nochmal mehr übel. Die Befürchtungen waren noch nicht dramatisch genug beschrieben und sind noch schlimmer eingetroffen! Ebenso werden die obig beschriebenen Erscheinungen die Diskriminierungen auf einen Höchststand treiben, der letztendlich mit dem Faustrecht in Notwehr oder Revolution beendet werden wird. Ob es auch zum Ende der Menschheit führt, wage ich zu bezweifeln.
Aber einige Super-gehirne werden unfähig sein, ohne Messer oder ähnliches Werkzeug sich zu ernähren.
Und dann können in 1000 Jahren wieder Forscher vor den Ruinen in NewYork oder Dubai oder Shankhai und darüber nachdenken, wie es wohl damals auf der Erde ausgesehen haben kann…
So wie wir vor den Pyramiden in Ägypten stehen oder anderen Weltwundern…
Liebe Grüße
Wolfgang