Der Vergleich1 von Ostdeutschen mit „farblosen2 People of Colour“ wirkt zunächst provokant, rüttelt aber mitten im politischen Selbstbild des wiedervereinigten Deutschlands. Er öffnet den Blick auf eine bis heute bestehende Schieflage: die soziale, ökonomische und kulturelle Marginalisierung einer ganzen Bevölkerungsgruppe – mitten im eigenen Land.
Es geht dabei nicht um Ethnie oder Pigmentierung, sondern um die Erfahrung, dauerhaft fremdverwaltet zu werden. Um strukturelle Diskriminierung im Gewand ökonomischer Logik – und um eine tief verankerte Geringschätzung, die man nur merkt, wenn man sie selbst erlebt.
Demütigung und Ausverkauf
Was für viele Westdeutsche eine wirtschaftliche Notwendigkeit war, blieb für viele Ostdeutsche eine kollektive Demütigung: Die Treuhand. Millionen Arbeitsplätze vernichtet, Betriebe verscherbelt, ganze Regionen entkernt. Die industrielle Basis wurde nicht restrukturiert, sondern abgewickelt – von „westdeutschen Freunden“ mit Ministeriumssegen und moralischer Überlegenheit.
Selbst die Verwaltung kam unter Aufsicht westdeutscher Beamter, als wäre Verwaltungskompetenz eine genetische Eigenschaft, die jenseits der Elbe endet. 35 Jahre später dominieren in Ostdeutschland immer noch westdeutsche Entscheider in Justiz, Ministerien und Medien. Man könnte fragen: Wenn Integration das Ziel war – warum ist dann kaum jemand angekommen?
Die Entmachtung war total: wirtschaftlich, politisch, kulturell. Grundstücke verkauft, öffentliche Strukturen ausgelagert, Identität entwertet. Ostdeutschland blieb in weiten Teilen eine abhängige Ökonomie – ein Binnenkolonialgebiet im Herzen Europas, das von Fördermitteln lebt und vom Westen verwaltet wird.
Vergeudete Erfolge und selektives Gedächtnis
Es gab Erfolgsgeschichten – nur wollte sie kaum jemand hören. Das ostdeutsche Bildungssystem etwa: reformorientiert, effizient, erstaunlich modern. Mathematik und Naturwissenschaften auf Spitzenniveau, Schulmodelle mit skandinavischem Geist – bis sie westdeutschen Maßstäben „angepasst“ wurden. Von der pädagogischen Substanz blieb wenig.
Zugleich ignoriert man Unterschiede in Mentalität und Lebenshaltung, die im Westen selbstverständlich in Folkloreform überleben dürfen („der Schwabe spart“, „der Rheinländer feiert“). Nur der „Ossi“ bleibt als Karikatur übrig – halb bemitleidet, halb belächelt.
Medien: Der Westen spricht über den Osten
Noch immer bestimmen westdeutsche Redaktionen das Bild vom Osten – und sie reproduzieren es mit erstaunlicher Beharrlichkeit.
Ein Dialekt genügt für die Kamera, ein Plattenbau für das Setting. Differenzierung? Fehlanzeige. Ostdeutschland wird homogenisiert, als wäre Sachsen identisch mit Brandenburg. Die mediale Landkarte endet an der Elbe, und was östlich davon liegt, zeigt man meist nur, wenn es brennt – oder wählt.
Diese Filterblase verstärkt die Entfremdung: Ostdeutsche sehen sich nicht repräsentiert, sondern repräsentiert von anderen. Sie erkennen sich nicht im Bild wieder, das über sie zirkuliert. Bei Interviews werden oft die ostdeutschen Gesprächspartner herausgesucht, die am Stärksten durch Dialekt oder extreme Haltungen herausstechen.
AfD und politische Projektionen
Der Aufstieg der AfD wird gern als ostdeutsches Phänomen gedeutet – als Beweis kollektiver Rückständigkeit. Ironischerweise stammen viele ihrer Anführer aus dem Westen. Eine politische Zumutung wird ethnisiert: „die da drüben“ als Ursache des Problems.
In Wahrheit zeigt sich ein strukturelles Problem der gesamten Republik – der Zerfall politischer Sprache und Vertrauen. Was im Osten nur früher auffiel, frisst sich inzwischen längst auch durch den Westen.
Wut ohne Adresse
Die Wut der Ostdeutschen ist real – aber im politischen Diskurs bleibt sie ein symptomatisches Ärgernis. Man analysiert Wahlergebnisse, nicht Ursachen. Die kontinuierliche Missachtung von Lebensleistungen und biografischen Brüchen wird moralisch übertüncht: Wer wütend ist, wählt falsch. Punkt.
Von Kohl bis Merz zieht sich die Tradition des politischen Placebos: Versprechungen statt Lösungen, Integration als Einbahnstraße. Die moralische Siegerpose des Westens bleibt ihrerseits unreflektiert – Lernprozesse verlaufen nur in eine Richtung.
Der Vergleich zu People of Colour
Wer im Westen nie strukturell abgewertet wurde, versteht schwer, wie es sich anfühlt, ständig „nicht mitzuzählen“. Der Vergleich zu People of Colour zielt folglich nicht auf Hautfarbe, sondern auf Erfahrung: auf Machtlosigkeit, Entwertung, die Unmöglichkeit, als gleichberechtigt wahrgenommen zu werden.
Der Osten wartet bis heute auf seine eigene Symbolfigur, auf einen Martin Luther King seiner Identität. Ironischerweise hat er bereits einen Martin Luther – den Reformator aus Thüringen. Nur ging es ihm damals um Glauben, nicht um Gerechtigkeit. Vielleicht wäre es aber an der Zeit, beides miteinander zu verbinden: Aufbruch als geistige Selbstermächtigung.
Fazit
Dies ist kein nostalgisches Lamento, kein Opfermonolog. Es ist eine Zustandsbeschreibung eines Landes, das seine innere Grenze nie wirklich überschritten hat. Ich selbst – Ökonomischer Flüchtling, seit über 20 Jahren im Westen „angekommen“ – kenne beide Welten.
Die Jammerei mancher Ostdeutscher nervt mich. Aber das Wegsehen des Westens – die moralische Selbstgefälligkeit – noch mehr.
Es geht um etwas Tieferes: um enttäuschte Hoffnungen, um strukturelle Ungleichheit, um die Frage, warum ein vereintes Land immer noch zwei Sprachen spricht. Die eine: selbstgefällig, siegreich, westlich. Die andere: leise, wütend, ostdeutsch. Und keiner hört hin.
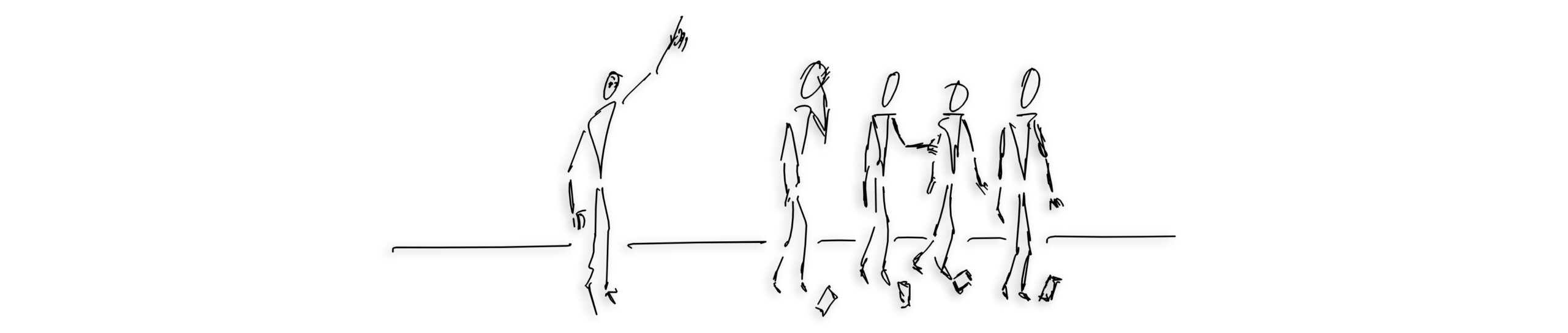
One thought on “Ossis – die „farblosen“ People of Colour?”