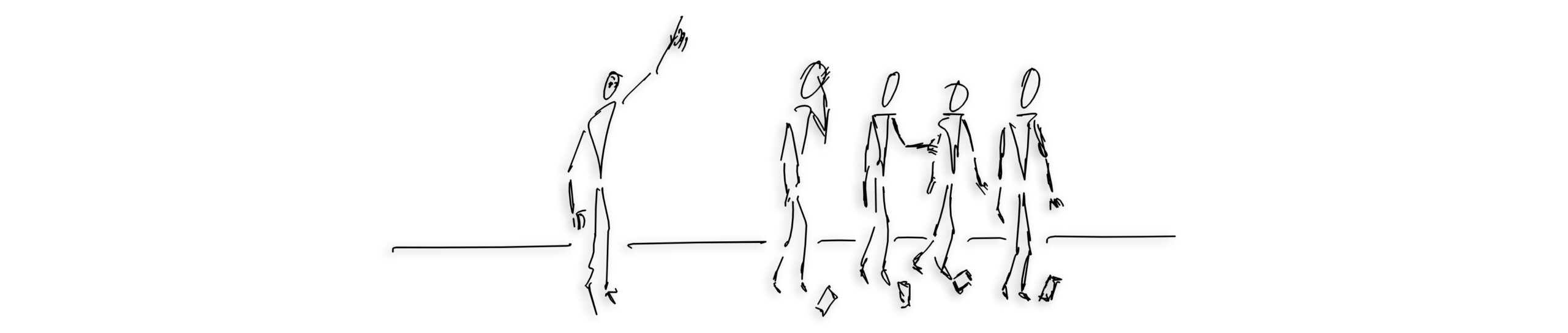Die Renaissance der Bauchentscheidung
Es scheint, als lebe die Wahrheit in der Politik auf Abruf. Fakten? Optional. Expertenmeinungen? Ein netter Bonus, aber nicht erforderlich. Stattdessen wird eine neue Währung der Macht immer wertvoller: Chuzpe, Selbstbewusstsein, dicke Eier. Und das funktioniert – erstaunlich gut sogar.
Trump hat es vorgemacht, seine Nachahmer folgen in Scharen. In Deutschland finden wir das Phänomen quer durch die Parteienlandschaft: Von der AfD, die sich als Alternative zur „Lügenpresse“ inszeniert, bis hin zu CDU/CSU-Politikern, die plötzlich mit einer Realität operieren, die wenig mit messbaren Fakten zu tun hat. Faktenloses Führen ist en vogue – aber warum eigentlich?
Die Psychologie der Faktenresistenz
Der Erfolg faktenloser Führung basiert auf einer Mischung psychologischer Mechanismen, die tief in uns verwurzelt sind:
- Der Backfire-Effekt: Menschen neigen dazu, an falschen Überzeugungen noch stärker festzuhalten, wenn sie mit gegenteiligen Fakten konfrontiert werden. Eine Korrektur bewirkt oft das Gegenteil des Erwünschten: Sie zementiert die Falschinformation.
- Cognitive Ease: Was leicht verständlich ist, wird als wahr empfunden. Komplexe Sachverhalte mit vielen Variablen (z. B. Klimapolitik, Migration, Wirtschaft) überfordern viele Menschen. Einfache, knackige Botschaften („Grenzen dicht!“, „Steuern runter!“, „Make America Great Again!“) hingegen sind einprägsam und fühlen sich intuitiv richtig an.
- Authority Bias: Wer mit Selbstbewusstsein auftritt, wird als kompetenter wahrgenommen – auch wenn er objektiv völlig danebenliegt. Studien zeigen, dass Menschen eher geneigt sind, charismatischen Autoritätspersonen zu folgen als rationalen Argumenten.
- Der Dunning-Kruger-Effekt: Wer wenig weiß, überschätzt oft seine Kompetenz. Gleichzeitig neigen Menschen dazu, sich an Führer zu klammern, die ihnen ein Gefühl von Klarheit und Sicherheit geben – selbst wenn diese faktisch falsch liegen.
- Die Belohnung der Dreistigkeit: Gesellschaftlich wird „Macher-Mentalität“ honoriert. Wer sich lautstark und ohne Zweifel äußert, wirkt handlungsfähig – im Gegensatz zu einem Politiker, der faktenbasiert, aber zögerlich und abwägend argumentiert.
Die mediale Verstärkung
Die Medien spielen eine entscheidende Rolle in dieser Dynamik. Polarisierende, provokante Aussagen generieren Klicks und Schlagzeilen. Wer die wildesten Thesen raushaut, bekommt die meiste Aufmerksamkeit. Algorithmen in sozialen Netzwerken bevorzugen einfache, emotionale Inhalte – genau die Art von Kommunikation, die faktenlose Führung begünstigt.
Bemerkenswert ist dabei, dass selbst Politiker, die in der Öffentlichkeit als völlig inkompetent wahrgenommen werden – etwa Andreas Scheuer, Jens Spahn oder Alexander Dobrindt – weiterhin eine große mediale Bühne erhalten. Ist das ein Versuch, schlechte Beispiele vorzuführen, oder ein Zeichen dafür, dass politische Netzwerke und mediale Mechanismen eine gewisse Immunität gegen offensichtliches Versagen gewähren?
Das unvermeidliche Scheitern – und dann?
Doch irgendwann bricht das Kartenhaus zusammen. Unvermeidlich kommt der Moment, in dem sich zeigt, dass faktenloses Führen nicht nachhaltig ist. Wirtschaftliche oder gesellschaftliche Krisen können nicht durch Rhetorik allein gelöst werden, und wenn die Illusion zerbricht, stellt sich die Frage: Wie konnte es dazu kommen?
Hier setzt der Mechanismus der kognitiven Dissonanz ein: Menschen, die einen Anführer unterstützt haben, wollen ihren Irrtum nicht eingestehen – das wäre ein Gesichtsverlust. Also werden Schuldige gesucht: Berater, Medien, das System, feindliche Kräfte. Die Strategie: Fehler nicht eingestehen, sondern die Verantwortung verschieben.
Für politische Akteure, die sich auf faktenloses Führen verlassen haben, gibt es mehrere Auswege:
- Der Opfer-Narrativ: „Wir wurden sabotiert, sonst hätten wir Erfolg gehabt.“ Ein Klassiker, der bei Anhängern oft funktioniert.
- Die Neuausrichtung: Eine plötzliche Wendung mit einer neuen politischen Richtung. Frühere Aussagen werden umgedeutet oder ignoriert.
- Der Sündenbock: Einzelne Exponenten werden geopfert, um das größere Narrativ zu retten. „Es war ein Fehler dieser Person, aber die Idee war richtig.“
- Der schleichende Rückzug: Ein langsames Verschwinden von der Bühne, während andere das Narrativ übernehmen oder abwandeln.
Der große Kater – Wie geht es weiter?
Was passiert, wenn der Bann gebrochen ist? Nach einer Ära faktenlosen Führens folgt oft ein brutales Erwachen. Der Trumpismus mag als Ideologie weiterleben, doch selbst überzeugte Anhänger könnten sich nach dem unausweichlichen Scheitern fragen: „Wie konnten wir so lange an diesem Irrsinn festhalten?“ Der politische Kater wird massiv sein.
Die Frage ist: Wie gehen Gesellschaft und Medien mit der Peinlichkeit danach um? Möglich sind verschiedene Szenarien:
- Vergessen und Verdrängen: Man kehrt zur Tagesordnung zurück, spricht nicht mehr über die Fehler der Vergangenheit und tut so, als wäre nichts gewesen.
- Neuer Mythos, neues Narrativ: Die gleiche Ideologie wird neu verpackt – diesmal mit vermeintlich besserer Führung.
- Schrittweise Aufarbeitung: Gesellschaft und Medien analysieren die Mechanismen, die faktenloses Führen ermöglicht haben, um zukünftige Wiederholungen zu verhindern.
- Zynismus und Resignation: Die Gesellschaft verliert endgültig das Vertrauen in politische Prozesse, was langfristig Raum für noch extremere Kräfte schaffen könnte.
Der Post-Trumpismus ist eine Blaupause für kommende Herausforderungen. Ob aus Fehlern gelernt wird oder ob das Spiel nur in einer neuen Variante weitergeht, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Der Kater wird kommen – die Frage ist, ob wir ihn auskurieren oder ihn einfach ignorieren.
Warum funktioniert das jetzt so gut?
Es ist kein Zufall, dass faktenloses Führen gerade jetzt Hochkonjunktur hat. Die Medienlandschaft hat sich radikal verändert – und mit ihr die Mechanismen, die bestimmen, welche Inhalte sichtbar sind und welche nicht. Früher dominierten klassische Print- und Rundfunkmedien, heute setzen soziale Netzwerke und digitale Plattformen die Agenda. Doch wer kontrolliert eigentlich die Medien? Gilt Volker Pispers’ alte Aussage noch, dass „die Medien nur fünf Familien gehören“?
Während traditionelle Medienhäuser noch existieren, hat sich die Machtverteilung in der Medienbereitstellung massiv verschoben. Algorithmen bestimmen, welche Nachrichten Millionen Menschen zu Gesicht bekommen – nicht Redakteure oder Journalisten mit einem Ethos für Fakten.
Aufmerksamkeit ist die neue Währung, und Clickbait-Mechanismen sorgen dafür, dass provokante, skandalöse oder emotionale Inhalte bevorzugt werden. Die Folge: Fakten verlieren an Wert, während Erregung und Polarisierung dominieren.
Die Intelligenz bleibt dabei oft auf der Strecke. Tiefgehende Analysen, komplexe Zusammenhänge oder differenzierte Argumentationen haben es schwer gegen simple, empörungsgetriebene Schlagzeilen. Die digitale Welt belohnt das, was am lautesten ist – nicht das, was am klügsten ist. So entsteht ein Umfeld, in dem faktenloses Führen nicht nur möglich, sondern geradezu profitabel wird.