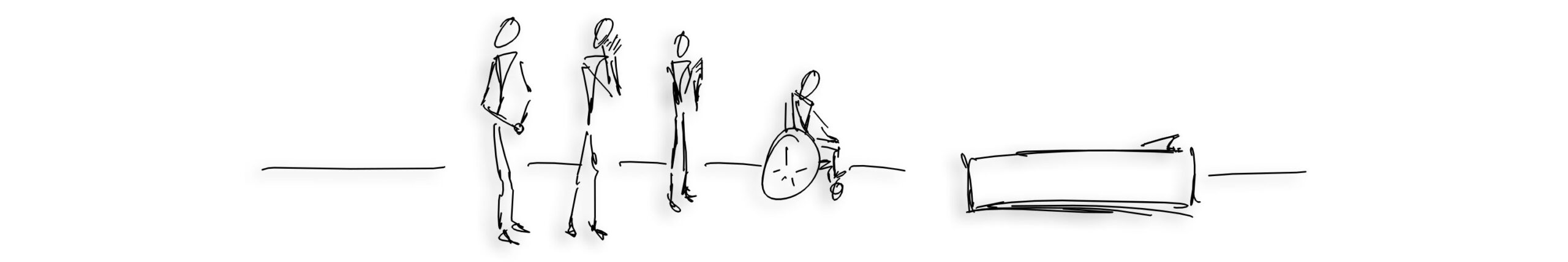Am 21. April 2025 ist Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren in der Vatikanstadt verstorben. Als erster Papst aus Lateinamerika und Mitglied des Jesuitenordens hatte er die katholische Kirche seit 2013 geprägt – mit Demut, Reformbereitschaft und einem deutlichen Fokus auf soziale Gerechtigkeit. Sein Tod ist nicht nur ein Einschnitt für die Gläubigen, sondern auch ein weltweites mediales und politisches Ereignis. Und wie immer, wenn ein Papst stirbt, melden sich Stimmen aus der Politik – mit großen Worten und kleinen Absichten.
Politische Beileidsbekundungen – zwischen Trauer und Taktik
„Ein Mann des Friedens“, „eine moralische Leitfigur unserer Zeit“, „eine Stimme für die Armen“ – mit diesen und ähnlichen Worten haben Politiker weltweit den Tod von Franziskus kommentiert. US-Vizepräsident J.D. Vance, der den Papst noch kurz vor dessen Tod traf, sprach von einem „herausfordernden Lehrer“. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz nannte ihn einen „Fürsprecher der Schwachen“. Diese Würdigungen wirken auf den ersten Blick ehrenvoll – und sind es möglicherweise auch. Doch sie werfen eine alte Frage neu auf: Wie ehrlich ist die politische Anteilnahme, wenn das politische Handeln so oft im kompletten Widerspruch zu den gelobten Werten steht?
Auch deutsche Politiker reihen sich ein – mit zweifelhaften Motiven?
Gerade in Deutschland, wo die Bindung zur katholischen Kirche historisch wie kulturell tief verankert ist, positionieren sich führende Politiker schnell und öffentlichkeitswirksam. Doch nicht immer geschieht dies aus ehrlichem Gedenken. Vielmehr scheint es, als wollten sich einige Akteure symbolisch aufwerten – durch Nähe zu einer moralischen Instanz, die ihnen selbst längst nicht mehr zugeschrieben wird. Der Tod von Franziskus wird so auch zur Bühne nationaler Selbstdarstellung: Man trauert mit, man zitiert christliche Werte – während man gleichzeitig migrationspolitisch hart agiert, soziale Ungleichheit zementiert und in vielen Fragen der Moral taktisch statt ethisch entscheidet. Und nein, ich nenne jetzt keine Namen!
Die Glaubwürdigkeit dieser Bekundungen bleibt fraglich. Wenn dieselben Stimmen, die Franziskus als Mahner für Gerechtigkeit feiern, seine Grundbotschaften im Alltag ignorieren, entsteht ein Eindruck der Heuchelei. Die Beileidsbekundung wird zur symbolischen Aufladung des eigenen Profils – nicht zur Auseinandersetzung mit dem, was Franziskus wirklich forderte.
Reden vom Gewissen – und Handeln im Gegensatz
Franziskus war ein entschiedener Gegner sozialer Ungleichheit, ein Kritiker des globalen Kapitalismus, ein Kritiker und Mahner in der Flüchtlingspolitik. Seine Worte waren unbequem – für Politik, Wirtschaft und Kirche selbst. Doch genau jene politischen Akteure, die jetzt seine Stimme für die Schwachen loben, sind nicht selten dieselben, die Abschottungspolitik betreiben, Rüstungsexporte ermöglichen und soziale Spaltung vertiefen. Die Diskrepanz zwischen Wort und Tat war selten so sichtbar.
Die Kirche als moralische Kulisse
In einer Zeit, in der die katholische Kirche selbst an Autorität eingebüßt hat, wird ihre symbolische Kraft umso stärker politisch genutzt. Der Tod von Papst Franziskus ist auch deshalb so präsent, weil er eine moralische Leerstelle füllt, die in der Politik zunehmend spürbar wird. Doch wer diese Leerstelle rhetorisch besetzt, sollte sie auch ethisch füllen können. Ansonsten bleibt der Bezug auf den Papst bloße Staffage – ein moralischer Anstrich für eine amoralische Praxis.
Ein Vermächtnis, das Hoffnung macht – und Ernüchterung zugleich
Franziskus hinterlässt eine klare Botschaft: Für Gerechtigkeit eintreten, Mitgefühl leben, Verantwortung übernehmen. Würde diese Haltung Eingang in die Weltpolitik finden, könnte sie tatsächlich zu einer besseren, humaneren, gerechteren Welt führen. Seine Perspektive auf globale Ungleichheit, auf Umweltfragen, auf das Miteinander der Kulturen wäre eine echte Orientierung in einer Zeit der Orientierungslosigkeit.
Doch Grund für besonderen Optimismus gibt es nicht. Zu eingefahren sind die politischen Systeme, zu festgefahren die Interessen, zu oberflächlich der Bezug zur Moral. Die Chance, das Vermächtnis Franziskus’ ernsthaft zu nutzen, ist real – aber sie wird wohl verstreichen wie so viele andere. Und das macht seinen Tod nicht nur traurig, sondern auch tragisch.
Fazit: Franziskus verdient mehr als PR
Der Tod von Papst Franziskus markiert das Ende einer Ära. Und er stellt uns vor eine unbequeme Wahrheit: Wer moralisch spricht, sollte moralisch handeln. Die Ehrung Franziskus’ darf nicht zur rhetorischen Kulisse werden – sie sollte Mahnung sein. Für mehr politische Aufrichtigkeit, mehr soziale Verantwortung und den Mut, unbequeme Wahrheiten nicht nur zu benennen, sondern auch umzusetzen. Alles andere wäre Heuchelei – und Franziskus nicht würdig.