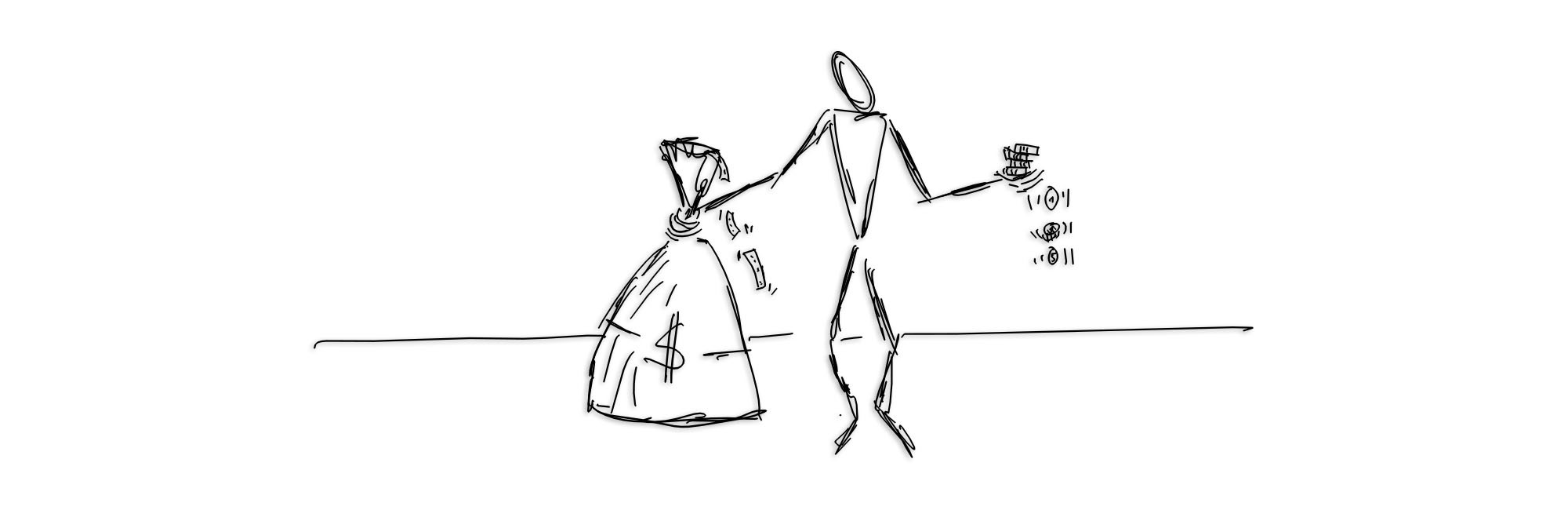Was für eine interessante Meldung aus Kanada – ein Vorschlag für ein neues Ethik-Gesetz!
Die politische Landschaft Kanadas steht erneut vor einer potenziell weitreichenden Veränderung: Der konservative Oppositionsführer Pierre Poilievre hat den sogenannten „Accountability Act 2.0“ vorgestellt. Ziel ist es, die bestehenden Ethikvorschriften drastisch zu verschärfen. Poilievre reagiert damit auf wachsende öffentliche Kritik an undurchsichtigen Lobbypraktiken und möglichen Interessenkonflikten — insbesondere im Umfeld prominenter Persönlichkeiten wie Mark Carney.
Der Plan verspricht mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht. Doch was genau steckt hinter diesem Vorstoß, und welche Auswirkungen könnte er auf Kanadas politisches System haben?
Das Herzstück: Verbot von Schattenlobbyismus
Ein zentrales Element des „Accountability Act 2.0“ ist das geplante Verbot von sogenanntem Schattenlobbyismus. Unter Schattenlobbyismus versteht man Versuche, politische Entscheidungen im Hintergrund zu beeinflussen, ohne sich offiziell als Lobbyist zu registrieren — eine Praxis, die bisher schwer zu regulieren war.
Poilievres Vorschlag sieht deshalb vor, dass künftig jeder, der Regierungsbeamte im Zusammenhang mit seinen eigenen oder unternehmerischen Interessen berät, sich offiziell als Lobbyist registrieren muss. Zudem sollen persönliche Vorteile, die sich aus politischen Entscheidungen ergeben könnten, umfassend offengelegt werden. Wer gegen diese Regeln verstößt, müsste mit deutlich höheren Strafzahlungen von bis zu 10.000 Dollar rechnen. Auch ein Verbot der Nutzung von Steueroasen durch Kabinettsminister ist Bestandteil des Pakets.
Durch diese Maßnahmen will Poilievre laut eigenen Aussagen verhindern, dass verdeckte Einflussnahme weiterhin möglich bleibt, und damit Vertrauen in die Regierungsarbeit stärken.
Einordnung: Schattenlobbyismus war auch schon in anderen Kontexten ein Problem. Mehr dazu in meinem Artikel über Das Risiko politischer Narrative: Wenn die Fassade bröckelt.
Transparenz als Pflicht: Offenlegung finanzieller Interessen
Neben der Einschränkung von Lobbypraktiken sieht der Entwurf ebenfalls eine Verschärfung der Vermögensoffenlegung für gewählte Amtsträger vor. Politiker müssten künftig sämtliche Vermögenswerte offenlegen, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, beispielsweise bei Beträgen über 1.000 Dollar. Ebenso wäre die Angabe aller Einkommensquellen verpflichtend, sobald diese jährlich 200 Dollar übersteigen. Auch Verbindlichkeiten, die größer als 10.000 Dollar sind, müssten gemeldet werden. Ergänzend dazu sollen Geschenke, gesponserte Reisen, Bankkonten, Kredite und Investitionen in transparenter Form offengelegt werden.
Das Ziel dieser umfassenden Offenlegungspflichten ist es, potenzielle Interessenkonflikte frühzeitig zu erkennen und das öffentliche Vertrauen in politische Institutionen zu stärken.
Inspiration: Ein ähnliches Transparenzmodell analysierte ich bereits in meinem Artikel zur Das Wissen der Mächtigen – Zwischen Unwissenheit und Lüge.
Das Carney-Schlupfloch: Neue Regeln für Führungskandidaten
Besondere Aufmerksamkeit widmet der Entwurf dem sogenannten Carney-Schlupfloch. Bislang konnten prominente Persönlichkeiten wie Mark Carney, ehemaliger Chef der Bank of England, als politische Führungskandidaten auftreten, ohne umfassend ihre finanziellen Interessen offenzulegen. Poilievre möchte das ändern: Führungskandidaten sollen ihre finanziellen Vermögenswerte spätestens 30 Tage nach ihrer offiziellen Kandidatur dem Ethikkommissar melden. Diese Informationen müssten dann innerhalb von 60 Tagen öffentlich gemacht werden. Vermögenswerte, die potenzielle Interessenkonflikte bergen, müssten verkauft werden. Zudem müssten die Kandidaten offenlegen, in welchen Ländern sie in den vergangenen sieben Jahren Steuern gezahlt haben.
Mit dieser Reform will Poilievre verhindern, dass verdeckte finanzielle Interessen politische Entscheidungen beeinflussen und damit Integrität und Transparenz in der politischen Führung gewährleisten.
Vertiefung: Warum solche Offenlegungsregeln wichtig sind, beleuchte ich in meinem Beitrag zur Warum unsere Demokratie nicht existiert – und was an ihre Stelle tritt.
Kritische Einordnung: Chancen und Risiken der Reform
Auch wenn Poilievres Vorschläge prinzipiell in Richtung größerer Transparenz und Rechenschaftspflicht gehen, bleiben Fragen offen. Es ist beispielsweise unklar, ob strengere Regeln tatsächlich verhindern können, dass informelle Einflussnahme weiterhin stattfindet. Ebenso könnte die Verpflichtung zu umfassenden Offenlegungen potenziell abschreckend auf qualifizierte Kandidaten wirken. Schließlich stellt sich auch die Frage, ob eine Umsetzung solcher umfassenden Reformen auf breiter politischer Basis realistisch ist.
Unstrittig bleibt jedoch: Der öffentliche Druck nach mehr Transparenz wächst — nicht nur in Kanada. Poilievres Entwurf könnte deshalb Signalwirkung weit über die Grenzen hinaus entfalten.
Poilievres Initiative: Ein Kontrast zum Kurs von Philipp Amthor
Interessanterweise steht Poilievres Vorstoß im krassen Gegensatz zu Entwicklungen in Deutschland, wo zuletzt der CDU-Politiker Philipp Amthor eine Initiative unterstützte, die auf eine Einschränkung des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) hinauslief. Während Poilievre Transparenz und Rechenschaftspflicht stärken möchte, hätte Amthors Ansatz Bürgerrechte und staatliche Transparenz eher eingeschränkt.
Gerade angesichts der zunehmenden Intransparenz im deutschen Politikbetrieb erscheint eine gesetzgeberische Initiative nach dem Vorbild des „Accountability Act 2.0“ auch hierzulande mehr als überfällig. Striktere Regeln für Lobbyismus, verpflichtende Offenlegungen und echte Sanktionen könnten das Vertrauen in politische Institutionen wieder stärken — bevor es weiter erodiert.
Fazit: Ein ambitionierter, aber notwendiger Schritt
Der „Accountability Act 2.0“ ist in seiner Ausgestaltung ambitioniert. Pierre Poilievre setzt damit ein klares Zeichen gegen Korruption, Intransparenz und unzulässige Einflussnahme. Ob und wie weit diese Reformen umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Eine Politik, die sich konsequent an den Prinzipien Transparenz und Rechenschaftspflicht orientiert, ist für jede Demokratie überlebenswichtig.