Mehr als persönliche Erfahrung
Dass der Osten Deutschlands auch Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung als „fremdverwaltet“ wahrgenommen wird, ist kein isoliertes Gefühl einzelner Menschen, sondern ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Zahlreiche Studien und Berichte untermauern, dass Ostdeutsche weiterhin strukturell benachteiligt sind – wirtschaftlich, politisch und kulturell. So beträgt die Lohnlücke gegenüber Westdeutschland weiterhin über 12.000 Euro pro Jahr, wobei sich diese Differenz seit Jahren kaum verringert. Auch die Tarifbindung ist im Osten deutlich schwächer ausgeprägt, was zu einem erhöhten Anteil geringfügig bezahlter Jobs und einem breit gefächerten Niedriglohnsektor führt. Zudem ist die soziale Infrastruktur in vielen Regionen durch Abwanderung und Überalterung stark belastet, was das Gefühl von Abgehängtheit weiter verstärkt.
Auch politisch und kulturell sind Ostdeutsche unterrepräsentiert, was top besetzte Führungspositionen betrifft. Studien zeigen, dass nur etwa 3,5 Prozent dieser Positionen von Ostdeutschen in Politik, Wirtschaft, Justiz und Wissenschaft besetzt werden. Die Folgen sind eine anhaltende Fremdverwaltung und geringe Teilhabe an Macht- und Entscheidungsstrukturen. Viele ostdeutsche Regionen bleiben wirtschaftlich schwach und sind strukturell benachteiligt – was manchen Experten zufolge einer Binnenkolonialisierung gleichkommt.
Parallelen zu People of Colour – Nicht Hautfarbe, sondern Erfahrung
Mein Vergleich zu People of Colour zielt nicht auf ethnische Merkmale, sondern auf die geteilte Erfahrung von Entwertung, Benachteiligung und Machtlosigkeit ab. Diese Erfahrung gehört für viele Ostdeutsche zum Alltag – geprägt durch erlebte Ungleichheit in Einkommen, Chancen und gesellschaftlicher Wahrnehmung. Immer mehr Stimmen aus Wissenschaft und Gesellschaft betonen, dass es bei der Betrachtung solcher Ungleichheiten nicht um Hautfarbe, sondern um strukturelle, historische und kulturelle Diskriminierungsformen geht, die in Deutschland auch im nationalen Kontext gelten. Der Vergleich öffnet damit einen wichtigen Blickwinkel, um systemische Probleme von Ausschluss und Nicht-Zugehörigkeit besser zu verstehen.
Mediale und politische Verdrängung als gemeinsamer Nenner
Es zeigt sich auch, dass Medienbilder von Ostdeutschland oft stereotyp und von westlichen Redaktionen geprägt sind. Eine differenzierte Darstellung der vielfältigen ostdeutschen Lebenswirklichkeiten fehlt weitgehend. Stattdessen dominiert die mediale Reduktion auf Klischees, die einzelne Regionen homogenisieren und politische Entwicklungen wie den Aufstieg der AfD simplifizieren. Dies trägt zur Verstärkung von Entfremdung und Missrepräsentanz bei. Solche politischen Projektionen verkennen die tieferliegenden sozialen und wirtschaftlichen Ursachen der Unzufriedenheit und spiegeln damit eine Form gesellschaftlicher Verdrängung wider.
Externe Stimmen bestätigen die kritische Perspektive
Diese kritische Perspektive findet sich in einer Fülle von Studien und gesellschaftspolitischen Analysen wieder. Sozialwissenschaftliche Untersuchungen zeigen, wie die Ungleichheit und Ausgrenzung im Osten Deutschlands nicht nur wirtschaftlicher Natur sind, sondern auch über Stereotypisierungen und Diskriminierungen wirken. Die anhaltende Benachteiligung in Einkommen, Vermögen, politischer Repräsentanz und kultureller Anerkennung wird breit beschrieben und analysiert. Dies bestätigt, dass die von mir geäußerte Sicht nicht eine Einzelerfahrung, sondern eine kollektive Realität abbildet, die vielerorts wahrgenommen und diskutiert wird.
Warum es wichtig ist, das anzuerkennen
Die Anerkennung dieser geteilten Erfahrungen und strukturellen Probleme ist ein erster und entscheidender Schritt zu echter gesellschaftlicher Integration und Gerechtigkeit. Wer Ostdeutschland als vollwertigen Teil der Gesellschaft begreifen möchte, muss die systemischen Benachteiligungen offen benennen und adressieren. Nur so kann die tiefsitzende Enttäuschung auf beiden Seiten überwunden werden. Es braucht konkrete Maßnahmen: vom Ausbau der Infrastruktur, über bessere Arbeitsmarktchancen bis hin zu einer fairen Repräsentation in den Medien und politischen Institutionen.
Die Debatte um „Ossis als People of Colour“ ist damit mehr als ein provokanter Vergleich: Sie ist ein gesellschaftlicher Weckruf, der längst unabhängig von meiner Perspektive in Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit angekommen ist und der eine veränderte soziale Wirklichkeit sichtbar macht.
Quellen und weiterführende Links:
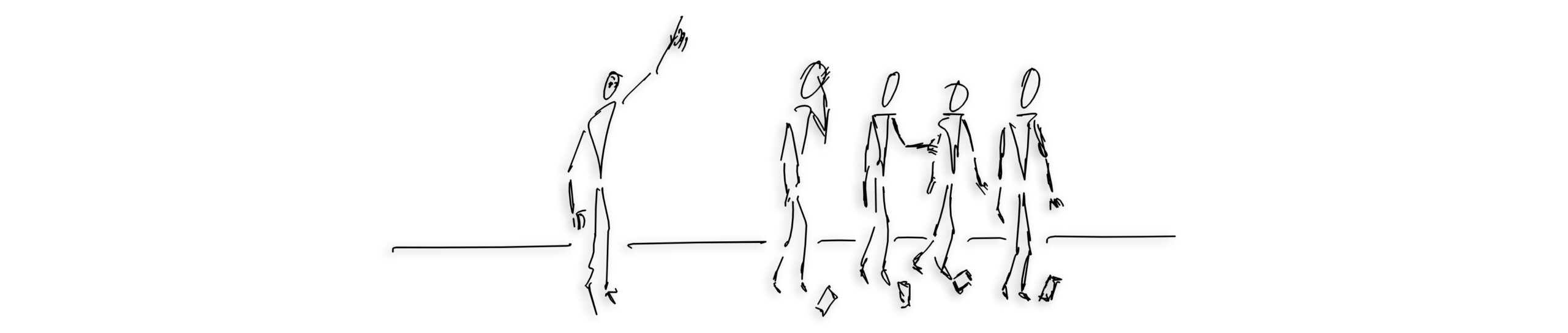
guten Morgen, es ist einfach, andere „Statistiken“ aufzuführen und den Weckruf zu starten und mit eigenen Erfahrungen zu belegen. Und ja – ich sehe die Verlustängste und Widerstände gegen Teilen überall in meiner Umgebung! Einfach ***Mensch-sein*** ist nicht mehr überall möglich!
Wir als Gesellschaft leisten uns luxusartig eine Verwaltung wie anderswo ein Reitpferd ohne Reiten zu können.
Wir leisten uns strafbare Diskreminierung an zig Stellen, und schaffen nicht nur das Wegsehen und Verschweigen, sondern auch noch mitmachen durch nichts-tun!
Wir leisten uns auch eine Presse und Sozial-Media, die genau daran verdient!
Wir brauchen keinen Putin, um uns kaputt zu machen – „Wir schaffen das!“ – schon alleine.
Solange Verwaltung nicht -Von Oben- umdenkt und handelt, wird dieses Unwohlgefühl nirgendwo aufhören!
— ein Menschenleben — ruiniert? was soll’s, solange es nicht das eigene ist!
Unser Zusammenleben ist mehr zum geistigen Gefängnis geworden!
Geregelt von Verboten –
und die Kreativität richtet sich sprachlich aus in Zwängen: man MUSS, DARF NICHT usw…
Habe gestern noch bestritten, das die Gedanken frei sind!
Begründung:
A) wir denken im Rahmen unserer Erfahrungen und Möglichkeiten — vorhandene Grundlagen…
B) wir prüfen ihre Realisation und verwerfen sie, wenn sie nicht umsetzbar sind.
C) Wir träumen nicht vom Leben ohne Wasser und Luft zum Atmen – wir sind nicht frei in den Gedanken!
und weil wir uns nicht wagen, unmögliches zu denken, sind Gedanken eben sehr begrenzt!
Und leider sind solche, wie obige Analysen, Erkenntnisse nicht anderes, als neue Grenzen zu kreieren!
Die Gewohnheit des Wohlstandes, des daraus gewachsenen Neides und Verlustängste, machen uns irgendwie zu Un-menschen.
ICH – ICH – ICH – ICH – ICH – ICH – und dann lange Nichts …
Wo bleibt das WIR ???
Ob jetzt über die Benachteiligung des Ostens, der Migranten, der Rentner oder was auch immer diskutiert wird, WIR sind zu FAUL, zu OBERFLÄCHLICH, um es als WIR zu ändern!!!
Irgendwie macht sich mein Gefühl, als Einzel-kämpfer leben zu müssen, immer deutlicher und schmerzhafter bemerkbar!
Das finde ich sehr interessant. Den Gedanken/ den Vergleich mit den POC in den USA hatte ich vor Jahren auch mal (vermutlich ist das also nichts besonderes, ich bin kein besonders großer Denker). Alles stimmt, keine Widerrede, nur: wenn wir uns mit den POC vergleichen und uns in einer ähnlichen Situation verorten, mit der gleichen Stigmatisierung, Abwertung etc. kommt bei mir auch der Gedanke der Hoffnungslosigkeit auf. Man kann als POC noch so gut, so herausragend sein – es interessiert nicht. Man bekommt nicht das Gleiche wie der Mehrheitsdeutsche, man ist höchstens ein Vergleichsobjekt, der „X des Ostens“, genuin können wir ihnen gar nicht voraus sein, sie sind immer besser.
Hoffnungslose Schleife, macht mich mürbe. Und deshalb die Außenperspektive: machen wir doch einfach nicht mehr mit, folgen wir weder denen, die uns seit 35 Jahren (und eigentlich länger schon) vormachen, wie es zu laufen hat [haha], noch denen, die sich als „Alternativen“ aufstellen [und die nur im Trüben fischen].
Ich kenn das aus Ostasien, wo man manchmal bewusst falsches Englisch schreibt, einfach nur um sich nicht doch wieder nur als Reproduktion oder Emporkommendes vergleichen lassen zu müssen. Und schon entsteht was eigenes, was wieder Wert hat. Da können dann die Westler schauen (und gerne nachmachen), es kann einem egal sein. Was in Ostasien so alles kulturell und intellektuell entsteht: es ist faszinierend – und wieviel kommt davon an? Nix, weil wir ja lieber irgendwelchen „westlichen“ (was auch immer das ist) Denkern folgen wollen… Aber es ist den Leuten dort egal. Sie machen es einfach und es ist toll.