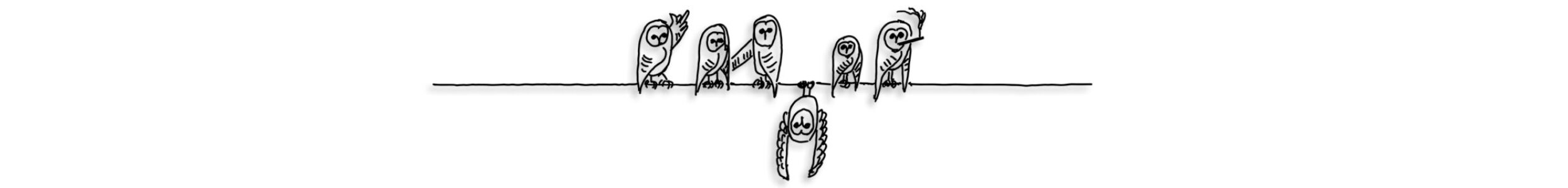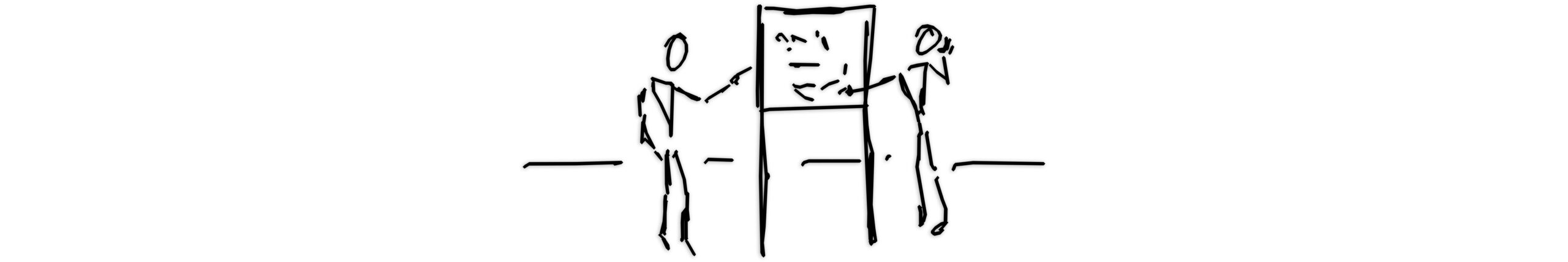Eine kleine Feldstudie über die erstaunliche Widerstandsfähigkeit von Dummheit im Scheinwerferlicht – und nicht nur dort.
Expertentum: Das, was übrig bleibt, wenn die Kameras aus sind
Fangen wir mit einem irritierenden Gedanken an: Ein Experte ist nicht der, der die beste Bauchbinde hat, sondern der, der auch ohne Mikrofon und Maske noch weiß, wovom er redet. Echtes Expertentum ist die unsexy Kombination aus Theorie, Praxis und der hässlichen Einsicht, dass man selbst trotz allem Wissen ständig dazulernt – und sich dabei regelmäßig irrt. Kurz: echte Experten produzieren Erkenntnisse, keine One-Liner.
Sie wühlen sich durch Papers, Daten, Code, Fehlermeldungen, Experimente und Scheitern. Sie sitzen nicht im Studio, sie sitzen in Labors, Büros, Werkshallen und im Zweifel nachts vor einem Monitor, der hartnäckig „Error“ sagt. Für diese Menschen ist die Welt kein Meinungsbuffet, sondern ein Problem, das man nur mit Mühe, Präzision und Zweifel halbwegs ordentlich vermessen kann. Kein Wunder, dass man sie in Talkshows so selten sieht – sie haben besseres zu tun, als zwischen Werbung und Twitter-Empörung 40 Sekunden „Einordnung“ zu liefern.
Und das ist der erste, kleine mediale Trick: Weil echte Experten rar, beschäftigt und notorisch differenzierend sind, wirkt irgendwann alles „expertig“, was nur halbwegs souverän klingt und eine Krawatte binden und tragen kann. Kompetenz wird durch Attitüde ersetzt. Ergebnis: die Bühne gehört den Falschen.
Die echten Experten: die stillen Leute im Off
Die wirklichen Fachleute eines Gebietes erkennt man daran, dass sie außerhalb ihrer Nische fast niemand erkennt. Ihre Sichtbarkeit korreliert erschreckend negativ mit ihrer Zeit, sich um ihre eigene Marke zu kümmern. Sie schreiben Aufsätze, keine Buchtitel mit „Revolution“, „Gamechanger“ oder „Jetzt erst recht“ im Namen. Sie korrigieren Kollegen, keine Talkshow-Gäste.
Diese Leute beginnen Sätze mit „So einfach ist das nicht“ und beenden sie mit „Wir brauchen mehr Daten“. Sie erzählen nicht von „der Wahrheit“, sondern von Konfidenzintervallen und Randbedingungen. Sie sind die, die im Publikum sitzen und leise die Stirn runzeln, wenn vorne jemand mit viel Selbstbewusstsein etwas behauptet, das nachweislich falsch ist. Nur dass niemand die Stirnrunzler einlädt.
Der Grund ist banal: Wer wirklich tief drin ist, weiß, wie kompliziert alles ist. Und Komplexität hat eine miserable Quote. Kein Mensch schaltet nach einem langen Arbeitstag ein, um sich in aller Ruhe erklären zu lassen, warum eine ehrliche Antwort lautet: „Kommt drauf an“. Also baut man stattdessen Bühnen für Menschen, die „Ich sage es Ihnen mal ganz klar“ sagen können – auch wenn das, was danach kommt, ungefähr so solide ist wie ein Kartenhaus im Windkanal.
Wer wird zum Experten gemacht? Die Casting-Show des Meinungsbetriebs
Mediales Expertentum ist keine Frage von Wissen, sondern von Verfügbarkeit und Verwendbarkeit. Es ist ein Casting, kein Graduiertenprogramm. Eingeladen wird, wer reibungsarm in die Dramaturgie passt – nicht, wer wirklich etwas zum Thema beitragen könnte. In der Praxis entstehen dabei ein paar wunderbare Figuren, die man mittlerweile in fast jeder Runde wiedererkennen kann.
- Der pensionierte Alleswisser: Früher mal im Thema, heute vor allem im Fernsehen. Seit zehn Jahren in keiner Studie mehr mitgearbeitet, aber dafür in jedem zweiten Studio gesessen. Hat Zeit, hat Routine, hat Anekdoten – und eine Wissensbasis, die langsam Patina ansetzt.
- Die Rampensau mit Excel-Allergie: Rhetorisch brillant, faktisch „solide informiert“ (also: ein paar Artikel quer gelesen). Kann in 90 Sekunden jede Katastrophe in eine wohlgeformte Metapher gießen und wirkt dabei so überzeugend, dass niemand nach Quellen fragt.
- Der Dauermeinungsproduzent: Egal welches Thema – Migration, Energie, Digitalisierung, KI, Weltuntergang – er hat eine Meinung. Und sie passt immer genau zu dem Lager, das gerade am lautesten klatscht oder buht. Expertise: wandelbar, wie ein Chamäleon mit Medienberater.
- Die bewährte Stimme: Schon hundertmal eingeladen, deshalb wieder eingeladen, weil: man weiß, was man bekommt. Kein Ausraster, keine Totalausfälle, dafür zuverlässig funktionierende Sätze mit hoher Social-Media-Verwertbarkeit. Wer einmal als Experte etikettiert wurde, bleibt es – solange er nicht schweigt.
- Der Provokationsakrobat: Fachlich randständig, dafür polemisch treffsicher. Er verbrennt keine Autos, aber Diskurse. Seine Aufgabe ist es, Sätze zu liefern, die am nächsten Tag Schlagzeilen machen. Dass man darüber vergisst, dass er nichts belegt, ist Feature, kein Bug.
All diese Figuren haben eines gemeinsam: Sie passen hervorragend in ein Format, das mehr Drama als Wahrheit braucht. Sie liefern Zuspitzung, Emotion, klare Fronten. Und sie unterwerfen sich ohne Murren der Grundregel: „Sei interessant, nicht exakt.“ Echte Fachlichkeit ist in diesem System ein nettes Bonus-Feature, aber keinesfalls zwingend.
Talkshow-Intelligenz: Hochbegabt im So-tun-als-ob
„Talkshow-Intelligenz“ ist die Begabung, in Echtzeit plausibel zu klingen, unabhängig davon, wie dünn die Faktenlage ist. Es ist ein wunderbares Talent: Man kann sich damit elegant durch Themenfelder bewegen, in denen andere jahrelang studieren, forschen oder arbeiten müssen – und kommt trotzdem am Ende mit mehr Redezeit davon.
Diese Kunst diszipliniert sich über ein paar goldene Regeln:
- Nie zögern: Wer nachdenkt, wirkt unsicher. Also wird spontan geantwortet, egal wie komplex die Frage ist. Notfalls hilft eine wohlklingende Floskel.
- Komplexität elegant beerdigen: Wo es kompliziert wird, hilft die große Geste. „Ich breche das mal runter“ ist oft der Auftakt zur faktischen Verkleinerung eines Problems, bis es in einen Soundbite passt.
- Story schlägt Studie: Statt Daten gibt es Einzelfälle, statt Metaanalysen gibt es „Ich kenne da jemanden…“. Anekdoten sind billiger als Forschung und emotional deutlich effizienter.
- Selbstbewusstsein als Beleg: Wer laut genug sagt „Die Wahrheit ist“, braucht keine Quellen mehr. Die Pose übernimmt die Funktion der Fußnote.
- Kontroverse als Geschäftsmodell: Ein differenziertes „Sowohl-als-auch“ bringt keine Klicks. Ein aggressives „So ist es und nicht anders“ schon. Also wird die Welt zur Bühne für Schwarz-Weiß-Malerei mit angebautem Empörungskanal.
Talkshow-Intelligenz ist damit so etwas wie intellektuelles Fast Food: schnell produziert, leicht konsumierbar, schwer verdaulich, langfristig ungesund. Kurzfristig befriedigend, langfristig dumm machend. Und wie beim Fast Food beschweren wir uns zwar über die Qualität, greifen aber immer wieder zu.
Multi-Expertentum: Der Universalgelehrte aus dem Fernsehstudio
In einer Welt, in der Fachbereiche explodieren, Spezialisierungen sich gegenseitig überholen und selbst Unterdisziplinen Doktorarbeiten füllen, wäre es logisch, dass Experten immer klarer eingrenzen, wozu sie wirklich etwas sagen können. Logisch – aber langweilig. Die mediale Realität kennt dagegen eine ganz andere Figur: den Multi-Experten.
Dieser Mensch ist in der Lage, innerhalb von einer Woche zu allem eine fundiert klingende Meinung zu haben: Montag Inflation, Dienstag Außenpolitik, Mittwoch KI, Donnerstag Klimaforschung, Freitag gesellschaftlicher Zusammenhalt. Man fragt sich irgendwann, wann diese Personen all die Studien, Berichte, Fachbücher und Daten gelesen haben wollen. Vermutlich zwischen Maske und Make-up-Korrektur.
Perfektes Beispiel hierfür ist Richard David Precht: Zu jedem Thema eine Meinung – von Quantenphysik über Hirnforschung bis hin zu Klimapolitik und Kindererziehung. Seine Beiträge zeichnen sich durch starke Vereinfachung komplexer Sachverhalte aus. Philosophische, politische und ökonomische Themen werden häufig stark verkürzt dargestellt, Differenzierungen, Gegenargumente und Unsicherheiten bleiben unterbelichtet. Statt analytischer Tiefe setzt er auf polemischen Stil: zugespitzte Thesen, moralische Appelle, provokante Formulierungen – perfekt für Aufmerksamkeit, miserabel für Erkenntnis. In gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Fragen klingt seine Meinungsstärke imposant, wird aber selten durch belastbare Daten, Fachliteratur oder empirische Studien gestützt.
Precht vermischt Rollen als Philosoph, Intellektueller, politischer Kommentator und Medienfigur, sodass verschwimmt, wann er argumentiert und wann er lediglich persönliche Überzeugungen präsentiert. Kritiker bemängeln seine selektive Argumentation: Beispiele werden passgenau ausgewählt, widersprechende Befunde ignoriert oder abgewertet. Mediale Logik – klare Schuldzuweisungen, einfache Lösungen, starke Narrative – ersetzt wissenschaftliche Logik mit offener Problemanalyse und erkenntnistheoretischer Zurückhaltung. Precht ist weniger als philosophischer Analytiker problematisch, sondern als öffentlicher Deuter komplexer Wirklichkeit. Seine Stärke liegt in der Popularisierung, seine Schwäche in der Präzision. Für einen Philosophiestudenten erkennt er erschreckend wenig Zusammenhänge, wo analytische Stringenz gefragt wäre. Ein echter Philosoph? Eher ein philosophischer Entertainer mit Doktortitel – ideal für Talkshows, fatal für tiefes Verstehen.
Die Wahrheit ist natürlich: Niemand kann das. Niemand kann in der heutigen Wissenslandschaft in fünf, sechs, sieben komplexen Feldern wirklich tief drin sein. Wer trotzdem ständig überall mitredet, ist kein Universalgelehrter, sondern ein Vollzeit-Meinungsdienstleister. Das ist an sich nicht verwerflich – solange nicht so getan wird, als wäre das Expertise. Die Reinform der Irreführung ist erreicht, wenn jemand sagt: „Ich bin da zwar kein Experte, aber…“ – und dann trotzdem zehn Minuten Redezeit bekommt.
Mediales Expertentum außerhalb der Studios: Gremien voller Relikte
Und das Schöne – oder Traurige, je nach Perspektive – ist: Dieses Phänomen beschränkt sich nicht auf die Medien. Es grassiert genauso in Gremien, Ausschüssen, Beratungsrunden und jenen heiligen Hallen, wo Politik und Verwaltung ihre „weisen“ Entscheidungen treffen. Dort kommen oft zu Ehren, auf die man im echten Arbeitsumfeld am liebsten verzichten würde. Leute, denen man im Tagesgeschäft mit einem gemurmelten „Entschuldigung, aber nein“ ausweichen würde, werden hier mit Meriten überhäuft, Titeln geschmückt und zu Orakeln erhoben. Peterprinzip auf Fachebene.
Folge dieser absurden Personalpolitik: weltfremde Normen und Gesetze, die in der echten Welt genauso viel taugen wie ein Kondom aus Sandpapier. Unreflektierte, veraltete Gedanken und Sichtweisen, die aus einer Zeit stammen, als Handys noch Klappen hatten und die Welt noch in Schwarz-Weiß gedruckt wurde. Diese „Experten“ produzieren Regulierungen, die niemanden schützen, den sie schützen sollten, und Probleme schaffen, wo keine waren. Warum? Weil sie die Komplexität der Realität nicht mehr mitkriegen – zu beschäftigt damit, ihre alten Thesen als neue Weisheiten zu verkaufen.
Ein Paradebeispiel für dieses Gremium- und Medien-Expertentum ist Hans-Werner Sinn: Jahrzehntelang ein Name, der wirtschaftswissenschaftlich Gewicht hatte. Heute? Eine wandelnde Zeitkapsel, die sich an verstaubten Vorstellungen festklammert, während die neuesten Entwicklungen – Digitalisierung, globale Lieferketten, Klimakrise – munter an ihm vorbeiziehen. Besonders eklatant: Sinn begreift nicht die zwingende Notwendigkeit, Umweltschutz zentral in wirtschaftliche Konzepte einzubauen, etwa über das Verursacherprinzip. Stattdessen bleibt er bei (antiquierten) Modellen hängen, die Ressourcen als unerschöpflich und Externalitäten als lästiges Detail abtun. In Talkshows und Gutachten wird er trotzdem immer wieder als „DER Wirtschaftsexperte“ geframed – weil er klar redet, kantig argumentiert und herrlich kontrovers zündelt. Aktuelle Forschung? Fehlanzeige. Komplexität der Welt? Überforderung pur. Aber Quote ist Quote, auch in Gremienräumen.
Ist dieses mediale Expertentum hilfreich? Spoiler: nein
Man könnte ja sagen: „Na gut, wenigstens reden die Leute über wichtige Themen. Ist doch besser als gar nichts, oder?“ – Das ist ungefähr so tröstlich wie der Satz: „Immerhin war das Flugzeug hübsch lackiert, auch wenn es abgestürzt ist.“ Nur weil man ein Problem bunt diskutiert, ist es nicht besser verstanden.
Das mediale Expertensystem produziert gleich mehrere Nebenwirkungen, die man freundlich als Kollateralschäden, ehrlicher als Schadensfälle bezeichnen könnte:
- Verwechslung von Kompetenz und Charisma: Wer gut reden kann, wirkt klug. Punkt. Das Gehirn des Zuschauers hat nicht die Bandbreite, nebenbei Fact-Checking zu betreiben. Also setzt sich der Eindruck fest: „Der redet flüssig, der wird schon wissen, wovon.“
- Verlust von Vertrauen: Wenn „Experten“ wiederholt spektakulär danebenliegen, werden nicht Fernsehsender kritisiert, sondern „die Experten“ generell. Wissenschaft wird mit Showpersonen verwechselt, Prognosefehler mit Erkenntnisversagen gleichgesetzt.
- Diskursverflachung: Komplexe Probleme werden in leicht verdauliche Lager geteilt: dafür oder dagegen, links oder rechts, pro oder kontra. Alles Dazwischen – also der Bereich, in dem echte Lösungen entstehen – wird systematisch rausgeschnitten.
- Fehlanreize für echte Fachleute: Wer ernsthaft im Thema ist, hat weder Lust noch Zeit, seine Aussagen auf Twitter-Tauglichkeit zu trimmen. Konsequenz: Sie bleiben weg. Und überlassen das Feld denen, die keine Skrupel haben, Dinge zu vereinfachen, bis sie falsch sind.
Am Ende bleibt ein Publikum zurück, das sich informiert fühlt – aber hauptsächlich mit Narrativen gefüttert wurde. Man hat Meinungen bekommen, keine Einsichten. Aber Meinungen fühlen sich besser an, sie verlangen weniger Denkarbeit. Und genau darauf setzt das System.
Was wir stattdessen bräuchten – theoretisch, wenn wir es ernst meinen würden
Wenn man es wirklich ernst meinen würde mit „Experten in den Medien“, müsste man ein paar heilige Kühe schlachten: die Idee der schnellen Meinung, der ewigen Klarheit, der perfekten Pointe zum Schluss. Man müsste anerkennen, dass ehrliche Antworten manchmal so spannend sind wie eine trockene Vorlesung – und ihnen trotzdem Raum geben.
Ein paar unbequeme, deshalb gute Ideen:
- Radikale Transparenz: Wer sitzt da? Was hat er zuletzt in dem Feld gearbeitet, publiziert, verantwortet? Und worin ist er explizit kein Experte? Bauchbinde mit Ehrlichkeitsmodus statt Hochglanz-Titel.
- Weniger Gesichter, mehr Inhalt: In Ruhe wenige Leute zu einem Thema sprechen lassen – statt fünf Pappkameraden in 60 Minuten durchjagen zu müssen, damit jeder einmal Empörung abliefern darf.
- Akzeptierte Unsicherheit: Es muss normal werden, dass Experten sagen dürfen: „Das wissen wir noch nicht.“ Und das Publikum nicht reflexartig „Aha! Alles nur geraten!“ schreit.
- Publikumserziehung: Wer Medien konsumiert, muss lernen, Eloquenz als Stilmittel zu erkennen, nicht als Qualitätsmerkmal. Skepsis gegenüber glatten Antworten ist kein Zynismus, sondern geistige Hygiene.
Aber all das setzt voraus, dass wir als Gesellschaft bereit sind, den Schmerz auszuhalten, dass die Welt komplizierter ist als ein Talkshow-Panel. Und dass man für echte Erkenntnisse mehr investieren muss als die Aufmerksamkeitsspanne zwischen zwei Werbeblöcken.
Zum Schluss: Weniger Show, mehr Wissen – aber bitte ohne Applaus
Wir leben in einer Welt, in der wir uns mit einem Klick mehr Wissen beschaffen könnten als jede Generation vor uns – und entscheiden uns freiwillig für Menschen, die uns das Denken abnehmen, indem sie es gar nicht erst anbieten. Das ist konsequent, aber leider nach unten.
Mediales Expertentum, wie es heute oft daherkommt, ist nicht dazu da, uns klüger zu machen, sondern ruhiger. Es liefert das beruhigende Gefühl, dass da „Leute mit Ahnung“ draufschauen – egal, wie dünn die Grundlage ist. Talkshow-Intelligenz ist der freundliche Lack auf einer kulturellen Bequemlichkeit: Wir wollen die Illusion von Orientierung, ohne die Mühe des Verstehens. Solange das so bleibt, werden die Lauten weiter eingeladen, die Klugen weiter arbeiten – und wir weiter verwechseln, wer von beiden uns wirklich helfen könnte. Und die Gremien produzieren weiter Gesetze, die in der Realität scheitern, bevor sie wirken.